We present to your attention a review article summarizing the information about ligamentum capitis femoris (LCF) available at the end of the 19th century. The text is prepared for machine translation using a service built into the blog from Google. In some cases, we have added links to quotations about LCF available on our resource, as well as to publications posted on the Internet.
Ueber das Ligamentum teres des
Hüftgelenks
von
Dr. E. Moser,
Assistent am anatomischen
Institut zu Strassburg.
Hierzu Tafel 4 u. 5.
Wohl über wenige Punkte der systematischen Anatomie gehen die Ansichten
der Autoren so weit auseinander als über das Ligamentum teres des Hüftgelenks.
Schon die makroskopische Beschreibung desselben stimmt nicht bei allen
Schriftstellern überein vollständig divergent, ja geradezu entgegengesetzt sind
aber die Hypothesen, welche über die morphologische Bedeutung und die Function
dieses Gebildes aufgestellt worden sind. Während die einen das Ligamentum teres
als ein wirkliches starkes Band auffassen und ihm demgemäss eine wichtige
Function im Bewegungsmechanismus des Hüftgelenkes zuschreiben, behaupten andere,
es trage den Namen eines Bandes völlig mit Unrecht, und leugnen demgemäss jede
mechanische Leistung desselben. Wieder andere glauben, die richtige Auffassung
zu haben, wenn sie das Ligamentum teres als Schutzorgan für zum Schenkelkopf
ziehende Gefässe betrachten, und rühmen die weise Natur, welche diese Gefässe
auf so sinnreiche Art vor Zerreissung geschützt habe. Aber auch diese Ansicht
hat ihrer Gegner, welche bestreiten, dass auf diesem Wege überhaupt Blut zum
Schenkelkopf gelange Wenn ich schliesslich noch anführe, dass nach anderer
Meinung das Band zur Umtreibung der Synovia im Gelenke dient, nach wieder einer
anderen dagegen eine höchst praktische Vorrichtung gegen den Bruch des
Pfannenbodens bei Fall auf den Trochanter major darstellt, während eine dritte
Anschauung dahin geht, dass es als die in das Gelenk eingewanderte
Ursprungssehne eines Muskels zu deuten sei, so habe ich zwar noch keineswegs
alle Theorien aufgezählt, die über das runde Band aufgestellt worden sind,
glaube aber doch damit nachgewiesen zu haben, dass über das Wesen und die Wirkung dieses
Bandes eine einheitliche Auffassung keineswegs erzielt ist. Wir werden an
späterer Stelle auf alle diese Ansichten einzugehen haben, hier sei nur
erwähnt, dass diese verschiedenartige Deutung des scheinbar so einfachen
Gebildes mit ein Grund war, der mich zu den vorliegenden Untersuchungen
veranlasste.
Es sind
verschiedene Ursachen, welche auch schon früher eine Reihe von Anatomen
anregten, sich immer wieder mit diesem Gegenstande zu befassen. Schon die ganz
eigenthümliche Lage des Ligamentum. teres, welches frei durch eine grosse
Gelenkhöhle hindurchzieht, musste eine besondere Aufmerksamkeit auf sich
lenken. Dadurch nimmt es eine ganz einzigartige Stellung im Organismus ein.
Aehnliche Bildungen haben wir scheinbar in den Kreuzbändern des Kniegelenks und
in der Bicepssehne im Schultergelenk. Eine Vergleichung ist trotzdem nicht
möglich, weil offenbar alle drei Organe eine verschiedene Bedeutung haben. Noch
unklarer, aber auch interessanter wurde die ganze Frage, als es bekannt wurde,
dass das Vorkommen des Ligamentum teres in der Ordnung der Säugethiere nicht
constant ist. Zuerst wurde das Fehlen des runden Bandes beim Orang bekannt,
später bei Echidna und Ornitorhynchus, schliesslich auch bei Elephant und Igel.
Es sind dies Thiere, die sich so wenig nahe stehen, dass von vornherein
anzunehmen war, die Abwesenheit des Ligamentum teres sei nicht bei allen auf
dieselben Ursachen zurückzuführen. Ausser den genannten Thieren, die bestimmt
kein Ligamentum teres haben, werden noch mehrere andere aufgezählt, von denen
es nach den Angaben in der Literatur zweifelhaft scheint, ob sie ein solches
Band besitzen. Auch auf diesen Punkt werden wir später zurückkommen.
Zu dem rein
anatomischen Interesse, welches das Ligamentum teres wachruft, kommt noch ein
mehr chirurgisches. In den Handbüchern. der Chirurgie liest man immer wieder,
der Schenkelkopf erhalte seine alleinige Blutzufuhr durch die Gefässe des
Ligamentum teres. Fast allgemein nahm man diese Angabe als Thatsache hin und zog
daraus gewisse Folgerungen bezüglich der Heilung von Schenkelhalsbrüchen.
Schliesslich sollten auch die bisher ganz unverständlichen Fälle von
angeborenem Fehlen des Ligamentum teres beim Menschen, die sich gelegentlich in
der Litteratur angeführt finden, auf ihre Richtigkeit untersucht und womöglich
erklärt werden. Wie man sieht, lag Veranlassung genug vor, das Ligamentum teres
einer erneuten Untersuchung zu unterziehen. Ob es mir dabei geglückt ist,
Manches zur Bestätigung schwankender und zur Aufklärung räthselhafter
Thatsachen beizutragen, mögen die nachfolgenden Seiten ergeben.
Um die Resultate
meiner Beobachtungen möglichst übersichtlich zu gestalten, werde ich sie in
vier Abschnitten behandeln. Der erste davon bezieht sich auf das Ligamentum
teres in vergleichend anatomischer Beziehung, der zweite beschäftigt sich mit
der Entwicklungsgeschichte und der dritte mit den Gefässverhältnissen des
Bandes beim Menschen. Im letzten Kapitel endlich sollen unter der Ueberschrift
Function und Theorie" die Erklärungsversuche, welche bisher zur
Feststellung der morphologischen und functionellen Bedeutung des runden Bandes
ausgesprochen worden sind, aufgezählt und kritisch beleuchtet werden.
I. Das Ligamentum
teres in vergleichend anatomischer Beziehung.
Wir stellen die vergleichend anatomischen Untersuchungen an die Spitze, weil sie uns geeignet scheinen, das meiste Licht über die ganze Frage vom Ligamentum teres auszubreiten. Es ist dieser Weg zur Lösung der vorliegenden Aufgabe kein neuer, aber auch der jüngste Autor über das Ligamentum teres, BUISSON, (1) der nur mit Hülfe der vergleichenden Anatomie sein Ziel zu erreichen sucht, ist keineswegs der erste, wie er glaubt, welcher diese Bahnen einschlägt. Vollständig auf vergleichend anatomischer Grundlage kamen WELCKER (2) und SUTTON (3) zu ihrer Auffassung des Ligamentum teres, und noch bedeutend früher haben schon OWEN (4) und MIVART (5) vergleichend anatomische Betrachtungen über das Ligamentum teres angestellt. Bevor wir jedoch darauf näher eingehen können, muss noch mit ein paar Worten des Ligamentum teres beim Menschen, als dem Ausgangspunkt unserer Untersuchungen, gedacht werden, hauptsächlich weil WELCKER (6) eine von der gewöhnlichen etwas abweichende Beschreibung des Bandes giebt.
1) Contribution à
l'étude des fonctions du Ligament rond. Thèse de Bordeaux 1888.
2) a) Ueber das Hüftgelenk nebst einigen Bemerkungen über Gelenke überhaupt. Zeitschr. f. Anat.
und Entw. 1876. S. 41-79.
b) Nachweis eines
Lig. interarticulare humeri u. s. w. Zeitschr. f. Anat. und Entw. 1877. S.
98-107.
c) Zur Anatomie des
Ligamentum teres femoris. Zeitschr. f. Anat. und Entw. 1877. S. 231-235.
d) Die Einwanderung
der Bicepssehne in das Armgelenk. Zeitschr. f. Anat. und Entw. 1878. S. 21-42.
3) The ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. XVII S. 191-193.
4) On the osteologyof the Chimpanzee and Orang. Transactions of the Zoological Society of London.
Vol. I. 1835. S. 365 f.
5) On the skeletonof the primates. Transact. Zool. Soc. Vol. VI. 1869. S. 210.
6) Ueber das Hüftgelenk. Zeitschr. f. Anat. und Entw. 1877. S. 60.
WELCKER lässt
nämlich die sogenannte hintere Wurzel, welche nach ihm das eigentliche
Ligamentum teres darstellt, nicht von dem hintern Rande der Incisura acetabuli
entspringen, sondern "von der Aussenfläche des Kapselbandes, indem von
dessen hinterem und unterem Theile eine Anzahl oberflächlich gelegener Fasern
zu einem platten Strange zusammentreten", und auf der dem Texte
beigegebenen Figur ist der Ursprung des Bandes direct auf den Schenkelhals
gezeichnet. Wenn aber das Band am Femur sowohl entspringt als auch inserirt, so
kann es, je nach den Bewegungen des Schenkels, wohl mehr oder weniger weit in
das Gelenk einrücken, in keiner Stellung jedoch stärker gespannt werden. Nach
meinen Erfahrungen trifft die gewöhnliche Beschreibung für das wohl
ausgebildete Band, wie wir es bei jungen kräftigen Leuten finden, vollkommen
zu. Die sehnenartige Grundlage wird von zwei fibrösen Bündeln gebildet, von
denen das stärkere von der hinteren Lippe der Incisura acetabuli, das
schwächere von der vorderen entspringt. Zwischen diesen beiden Strängen ist
eine dünne bindegewebige Lamelle ausgespannt. Beide Stränge convergiren gegen
die Fossa capitis und werden ringsherum von einer Synovialduplikatur umhüllt,
welche sich in Gestalt einer Falte aus der Fossa acetabuli auf das Band
hinüberschlägt. Infolge dieser Anordnung erscheint das wohlentwickelte
Ligamentum teres auf dem Querschnitt dreieckig, oder vielmehr dreihörnig, da
die einzelnen Seiten des Dreiecks etwas eingebogen sind. Entfernt man nach
Eröffnung des Gelenkes den Kopf so weit aus der Pfanne, dass das Band sich
anspannt, und dreht man dabei den Kopf so, dass die drei Kanten des Bandes
gerade gerichtet sind, so hat das Ligamentum teres die Gestalt einer
dreiseitigen Pyramide. Die Basis entspricht dem Ligamentum transversum und
einem Theil der Fossa acetabuli, die Kanten den beiden Schenkeln des Ligamentum
teres und der Synovialfalte. Bei intactem Gelenk ist die Pyramide in der
Richtung ihrer Längsaxe um die Wölbung des Femurkopfes gebogen, vom Ligamentum
transversum bis zur Fossa capitis.
In ähnlicher Weise
wie beim Menschen ist das Ligamentum teres bei der weitaus überwiegenden
Mehrzahl der Thiere zusammengesetzt. Doch kommen Ausnahmen von dieser Regel
vor, und zwar nach zweierlei Richtung. Einerseits giebt es eine Reihe von
Säugethieren, welche kein Ligamentum teres besitzen, andrerseits kennen wir
solche, bei denen das Band eine in das Gelenk vorspringende Falte darstellt,
also nicht ringsum frei ist. Als Thiere ohne rundes Band werden in der
Literatur genannt: Orang, Gibbon, Igel, Elephant, Rhinoceros, Nilpferd, Hyrax,
Tapir, Seehund, Seeotter, Walross, Helamys caffer, Macropus giganteus,
Megatherium, Bradypus tridactylus, Choloepus, Manis didactyla, Echidna hystrix
und setosa und Ornithorhynchus paradoxus. Als Falte soll das Band auftreten bei
Seehund und Tapir. Wie man sieht, sind es Angehörige der verschiedensten
Säugethierklassen, welche hier neben einander stehen und zwar solche, die sich
auf den ersten Blick unmöglich vereinigen lassen. Ja die beiden Thiere der
zweiten Reihe sind sogar schon in der ersten aufgezählt. Um zu erkennen, ob es
sich hier um einen unerklärlichen Zufall handle, oder ob diesen Erscheinungen
doch ein gemeinsames Gesetz zu Grunde liege, war es erforderlich, alle die
aufgeführten Thiere einzeln zu untersuchen. Es stand mir allerdings nur eine
beschränkte Anzahl vollständig erhaltener, frischer oder in Spiritus
conservirter Präparate zur Verfügung, aber dank dem liebenswürdigen
Entgegenkommen von Herrn Prof. Döderlein, Director der hiesigen
naturhistorischen Sammlungen, war es mir möglich, fast alle hier in Betracht
kommenden Skelete zu studiren. Bevor ich jedoch auf die einzelnen Fälle näher
eingehe, muss ich einige Worte in Betreff der Untersuchung am Skelet
voranschicken. Im Allgemeinen sind ja die Verhältnisse, auf die es bei solchen
Untersuchungen ankommt, auch am Skelet leicht zu erkennen. Es handelt sich um
Lage und Gestalt der Pfanne, bezw. des Schenkelkopfes, um das Fehlen oder
Vorhandensein und die Ausbildung der Incisura und Fossa acetabuli und der Fossa
capitis. Aber gerade der letzte Punkt macht grössere Schwierigkeiten, als man
im Voraus denken sollte. Eine gut ausgebildete, mehr oder minder central
liegende Fossa, wie wir sie von den meisten Säugethieren her kennen, ist
natürlich nicht zu übersehen. Anders dagegen, wenn die Grube so seicht ist,
dass man an ihrer Existenz überhaupt zweifeln kann, falls nicht Reste des
Bandes in ihr zu entdecken sind, oder wenn sie ganz seitlich an der Grenze der
überknorpelten Fläche des Gelenkkopfes gelagert ist. In dem letzteren Falle ist
ein doppelter Irrthum möglich. Einmal kann man die Grube ganz übersehen, oder
man glaubt, sie stelle blos eine Einbuchtung am Rande der überknorpelten Fläche
in diese selbst dar, und schliesst so auf ein wandständiges Band, während man
am frischen Präparate erkennt, dass doch noch ein kleiner überknorpelter Saum
zwischen Fossa capitis und Gelenkrand besteht und das Band in Wirklichkeit frei
ist. Auf alle diese Punkte werde ich im Folgenden öfter zurückkommen müssen.
Nach diesen Vorbemerkungen werde ich auf die einzelnen Fälle näher eingehen. 1. Orang-Utan (Pithecus satyrus). Die Abwesenheit des Ligamentum teres beim Orang wurde nach R. OWEN (1) zuerst von CAMPER (2) bemerkt, später wurde sie dann noch von MECKEL (3) hervorgehoben. Eingehender gewürdigt wurde sie aber erst von OWEN (1. c.) selbst, der in drei frischen Exemplaren von Orang das Band vermisste. Auch MIVART (4) geht in seiner Abhandlung "Ueber das Skelet der Primaten" näher auf diesen Punkt ein.
1) On the osteologyof the Chimpanzee and Orang. Transactions of the Zoological Society of London.
Vol. I.
2) Oeuvres T. I S.
121.
3) System der
vergleichenden Anatomie Bd. II Abth. II. S. 443.
4) On the skeletonof the primates S. 200.
Von da ab erwähnen alle
Autoren, die sich mit dem Ligamentum teres näher befassten, sein Fehlen beim
Orang als eine höchst auffällige Thatsache. Mir selbst stand für die
Untersuchung ein völlig intactes und mehrere skeletirte Exemplare von Pithecus
satyrus zur Verfügung und ich traf dabei folgende Verhältnisse. Die Pfanne
unterscheidet sich in keinem Punkte wesentlich von der des Menschen. Incisura
und Fossa acetabuli sind vorhanden. Durch erstere tritt eine Arteria acetabuli,
Zweig der A. circumflexa femoris medialis, in das Gelenk ein und verästelt sich
im Fette der Fossa acetabuli. Auch die Stellung der Pfanne zum Becken und ihre
Neigung zum Horizont ist ganz ähnlich wie beim Menschen. Ebenso lassen sich am
Femurkopf keine besonderen Unterschiede vom Menschen bemerken ausser dem
vollständigen Fehlen einer Grube für das runde Band. Auch von dem Bande selbst
ist keine Spur vorhanden. An den skeletirten Exemplaren war der Befund
derselbe, nur einmal war es zweifelhaft, ob nicht am Kopfe des Femur eine Fossa
und geringe Reste eines Bandes vorhanden waren. Leider war es gerade an der
Stelle, wo das Femur zur Verbindung des Skelets durchbohrt war. Wenn ich
demnach dieser Beobachtung kein grosses Gewicht beilegen kann, so gewinnt sie
dennoch Interesse, wenn wir verschiedene Angaben in der Literatur damit
vergleichen. MIVART (1) führt nämlich einen Fall an und bildet ihn auch ab, wo
jedes der beiden Femora eine kleine, aber deutliche Fossa capitis zeigte.
Ebenso sagt HUMPHRY (2) von dem Ligamentum teres des Orang: "It is very
small, or wanting althogether" und SAVORY: (3) "The Ligamentum teres
almost or entirely wanting in the orang-outang". Es scheint also das
Ligamentum teres beim Orang in einzelnen Fällen vorhanden zu sein.
Im Anschluss an den Orang ist noch mit ein paar Worten der übrigen Anthropoiden zu gedenken. Der Chimpanse besitzt nach übereinstimmender Angabe der Autoren immer ein rundes Band, nur MECKEL (4) behauptet, dass ihm die Fossa capitis fehle. Auch der Gorilla soll nach MECKEL keine Grube für das Ligamentum teres haben. In der Mehrzahl der Fälle ist jedoch Grube und Band sicher vorhanden, gelegentlich scheinen aber auch beide zu fehlen, denn auch MIVART (5) sagt, dass es ihm einige Mal unmöglich war, am Schenkelkopf eine Grube zu entdecken.
1) On the skeletonof the primates S. 200.
2) On the human skeleton S. 521.
3) On the ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Bd. VIII S. 294.
4) System der
vergl. Anatomie II. Bd. II. Abs. S. 443.
5) On the skeletonof the primates S. 200.
Ebenso führt WELCKER (6) zwei Fälle an, wo es nicht zu entscheiden war, ob eine Grube existirte oder nicht, und HARTMANN (7) und DEBIERRE (8) bemerken, dass das Band bei Gorilla "meist" vorkomme. Ueber ein Fehlen des Bandes beim Gibbon finde ich nur bei MECKEL (1) und HARTMANN (1. c.) Notizen. Nach ersterem besitzt das Femur keine Grube, nach letzterem kommt das Ligamentum teres bei dieser Gattung "fast regelmässig" vor.
6) Zeitschrift für
Anat. u. Entwgesch. 1877, S. 106 u. 107.
7) Handbuch der
Anatomie des Menschen 1881, S. 166.
8) Traité
élémentaire d'anatomie 1890, T. I S. 217.
1)
System der vergleichenden Anatomie II. Bd. II. Abth.
Es
scheint sich demnach als Resultat zu ergeben, dass das runde Band beim Orang in
der Regel, bei den übrigen Anthropoiden ausnahmsweise fehlt, ohne dass im Bau
des Gelenkes sich eine besondere Veranlassung dazu nachweisen lässt.
Als
Vertreter der übrigen Gattungen der Affen und Halbaffen untersuchte ich
Cercopithecus sabaeus, Cebus capucinus und Lemur varius, ohne jedoch etwas
Besonderes zu entdecken.
2.
Elephant. Für beide Arten des Elephanten, die indische und afrikanische, ist
die Abwesenheit des Ligamentum teres schon lange bekannt. Bereits MECKEL (1)
erwähnt diesen Umstand und nach ihm OWEN, (2) SAVORY, (3) HYRTL, (4) WELCKER
(1. c.), SUTTON (5) u. a. Die Gelenkpfanne ist am macerirten Knochen auffallend
flach, im allgemeinen aber einer Kugelpelotte entsprechend. Sie besitzt,
entgegen der gewöhnlichen Angabe, eine seichte Incisura acetabuli, welche von
einem Ligamentum transversum überbrückt ist, und ebenso eine kleine Fossa
acetabuli. Auffallend ist aber, dass die Eingangsebene der Pfanne fast
horizontal gestellt ist, so dass die durch die beiden Pfannen gelegten Ebenen
unter sehr stumpfem Winkel zusammentreffen, d. h. die Pfanne sieht fast direct
nach abwärts [Fig. 20]. Das Caput femoris hat fast die Gestalt einer Halbkugel
und schaut direct nach aufwärts. Ein Hals besteht nicht, sondern der Kopf sitzt
auf einer ganz schwachen Ausschweifung des Schaftes [Fig. 21]. Von einer Fossa
capitis ist keine Spur zu entdecken.
Beim
Nilpferd sind nach den Angaben der Literatur mir stand kein Skelet zur
Verfügung die Verhältnisse ganz ähnlich wie beim Elephanten, nur dass hier auch
die Incisura acetabuli fehlt (MECKEL, (6) WELCKER. (7)
Dem
Nilpferd und Elephanten schliesst sich das Nashorn an [Fig. 22 u. 23] (MECKEL,
WELCKER, HYRTL, (8) SUTTON (9).
1)
System der vergleichenden Anatomie II. Bd. II. Abth.
2)
On the Osteology of the Chimpanzee etc. S. 365 f.
3)
On the ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. VIII S. 293.
4)
Zeitschrift der k. k. Gesellschaft zu Wien 1846 Bd. I S. 58 und Handbuch der
topog. Anatomie 7. Aufl. II. Bd. S. 607.
5)
Journal of Anatomy and Physiology Vol. XX S. 52.
6)
System der vergleichenden Anatomie II. Bd. II. Abth. S. 438.
7)
Nachweis eines Lig. interarticulare humeri. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1877. S.
103.
8)
Handbuch der topogr. Anatomie II. Bd. S. 607.
9)
Journal of Anatomy and Physiology Vol. XX S. 191 ff.
Doch
ist hier die Incisura acetabuli deutlicher ausgesprochen und die Neigung der
Pfanne zum Horizont nicht so stark wie beim Elephanten. Dagegen ist der
Schenkelkopf gegen den Schaft etwas mehr abgesetzt als bei diesem. Das
Ligamentum teres fehlt auch beim Nashorn vollständig. – Ebenso mangelt nach
SUTTON (1) das runde Band bei Hyrax. Ich konnte bei einem Exemplar von Hyrax
capensis Folgendes beobachten. Die Pfanne [Fig. 24] zeigt eine kleine Incisura
und eine seichte Fossa acetabuli und ist ziemlich stark gegen den Horizont
geneigt. Der Schenkelkopf ist durch einen deutlich ausgeprägten Hals gegen den
Schaft abgesetzt. Vom hinteren unteren Umkreis des Kopfes springt eine kleine
Bucht in die überknorpelte Fläche vor [Fig. 25] und in ihr fand ich Reste eines
Bandes. Ich vermuthe deshalb, dass Hyrax ein Ligamentum teres besitzt, das aber
von der gewöhnlichen Form abweicht, indem es nicht frei das Gelenk durchzieht,
sondern eine wandständige, nach innen vorspringende Verdickung der Gelenkkapsel
darstellt. Aehnliche Verhältnisse finden wir beim Tapir, an dem WELCKER zum
Theil seine Untersuchungen über das Ligamentum teres angestellt hat. Auch hier
ist die Pfanne ziemlich flach [Fig. 26], wie beim Elephanten, und ihre
Eingangsebene dem Horizonte ziemlich zugeneigt. Die Incisura acetabuli ist viel
deutlicher als beim Elephanten, die Fossa jedoch sehr klein und seicht. Am
Oberschenkel [Fig 27] besteht auch hier noch kein Hals, wenn auch der Kopf sich
etwas mehr vom Schafte abhebt als beim Elephanten. Der Kopf ist nicht so
ausgesprochen nach aufwärts gerichtet, sondern wendet sich gleichzeitig etwas
medianwärts. An der medialen Seite des Kopfes liegt die Fossa capitis, jedoch
ganz excentrisch. Sie stellt eine tiefe Einbuchtung der den Kopf umgebenden
rauhen Knochenfläche dar. Diese eigenthümliche Lage der Fossa capitis mag
manchmal übersehen worden sein und so die Angabe bedingt haben, dass dem Tapir
das runde Band fehle HYRTL (2). Durch WELCKER (3) wissen wir, dass der Tapir
ein Ligamentum teres besitzt; und zwar fand es dieser Autor beim jungen Thiere "seitlich
im Pfannenboden wurzelnd, in Form einer abgeplatteten am freien Rande
verbreiterten Lamelle, welche pilasterartig am ventralen Theil des Kapselbandes
festsass". Das Band war wandständig, nur in der Nähe des Ligamentum
transversum war die mesenterialartige Synovial duplicatur, die es einhüllte,
von einer ganz kleinen Oeffnung durchbrochen. Beim erwachsenen Thiere traf
derselbe Forscher "ein völlig freies, längs seines ganzen Verlaufs
umgreifbares in dieser Beziehung dem Menschen völlig gleiches Ligamentum
teres".
1)
Journal of Anatomy and Physiology Vol. XX S. 191 ff.
2) Handbuch der topogr. Anatomie II. Bd.
3)
Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 1877.
Im
Anschluss an den Tapir studirte ich das Ligamentum teres des Pferdes. Da mir
hier frisches Material reichlich zur Verfügung stand, konnte ich die in
Betracht kommenden Verhältnisse genauer untersuchen. Es war dies aber auch
nothwendig, einmal weil das Ligamentum teres des Pferdes an sich schon sehr
interessant ist, vor allem aber weil SUTTON (1) seine Theorie über das
Ligamentum teres, die wir später zu besprechen haben werden, mit auf die
Beobachtungen am Pferde stützt. Beim Pferde haben wir eine Gelenkpfanne, die
ebenfalls etwas nach aussen überhängt, d. h. gegen den Horizont geneigt ist.
Sie bildet mit dem nicht sehr ausgebildeten Limbus cartilagineus eine Schale,
welche nicht ganz einer Halbkugel entspricht. Die Incisura acetabuli ist tief
und gross und vom Ligamentum transversum überbrückt. Sie führt in eine Fossa
acetabuli, die an Breite die Incisura nicht übertrifft und weder durch Grösse
noch durch Tiefe im Vergleich zu anderen Gelenken ausgezeichnet ist. Das Caput
femoris stellt mit seiner Gelenkfläche ungefähr eine Halbkugel dar, weicht aber
dadurch von der Kugelform ab, dass es oben lateralwärts verbreitert ist, und
zwar in einer schwächeren Krümmung, als sie dem übrigen Kopf entspricht. Die
Gelenkfläche sieht exquisit aufwärts. Ein Collum femoris ist nicht vorhanden,
der Kopf vielmehr fast in directer Verlängerung der Längsaxe des Fennur
angebracht. Am medialen Abhange der Gelenkfläche trifft man eine tiefe,
dreieckige Fossa capitis. Die Basis des Dreiecks hängt auf dem macerirten
Knochen direkt mit dem rauhen Umkreis der Gelenkfläche zusammen, ist am
frischen Präparate jedoch durch einen schmalen Knorpelsaum davon geschieden.
Die Spitze des Dreiecks ragt nach aufwärts etwa bis zu einem Drittel des
Umfangs in den Kopf hinein.
Sehr
eigenthümlich verhält sich nun das Ligamentum teres des Pferdes. Von den
Autoren, welche über das Ligamentum teres geschrieben haben, erwähnen nur
WELCKER (2) und SUTTON (1. c.) diese höchst auffallende Thatsache.
1)
The ligamentum teres. Journ. of Anat. and Phys. Vol. XVII.
2)
Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 1877. S. 105.
Das
Band besteht nämlich beim Pferde aus zwei wesentlich verschiedenen
Abtheilungen. Die eine davon verhält sich wie das gewöhnliche Ligamentum teres,
entspringt mit zwei Wurzeln an den beiden Lippen der Incisura acetabuli und
inserirt am Kopfe. Dazu kommt aber noch ein Strang, der viel stärker ist als
der eben beschriebene und von aussen her, in einer Rinne des Schambeins zum
Gelenk hinziehend, unter dem Ligamentum transversum eintritt, sich zwischen das
eigentliche Ligamentum teres und dem Schenkelkopf einschiebt und in der Fossa
capitis inserirt. Nach SUTTON ist dieser merkwürdige, gut fingerdicke Strang
die Ursprungssehne des M. pectineus. Dieser Autor beschreibt das Band
folgendermassen: "In the horse the ligament consists of two bands one
hidden within the joint termed the cotyloid portion; the other passes out of
the cavity to join the linea alba at its junction with the pubes, hence formed
the pubio - femoral portion. From this band the pectineus takes part of his
origin." MORRIS, (1) der das Band gleichfalls kennt, erwähnt es mit
folgenden Worten: "In the horse the round ligament passes out of the
acetabulum at the cotyloid notch, and under the name of the "pubo-femoral
ligament" is attached to the body and symphysis of the pubis. From this
ligament the pectineus muscle (as well as some of the muscles of abdomen)
arises. The fossa in the head of the femur in the horse is very deep and long
so that the ligament can as securely lock the bone as the biceps humeri of man
can the arme at the shoulder." Die Veterinäranatomen (z. B. LEISERING (2)
beschreiben dagegen einen Strang, der vom M. rectus abdominis abgeht und sich
in der Fossa capitis anheftet. Jedenfalls ist beim Pferde zu unterscheiden
zwischen dem eigentlichen Ligamentum teres und einem Verstärkungsstrange, der
vom Bauche herkommt. Das erstere verhält sich, wie vorhin beschrieben. Der
Verstärkungsstrang, Ligamentum pubo-femorale, ist bedeutend kräftiger als das
Band selbst. Es setzt sich an der Symphyse zusammen, hauptsächlich aus einem
Sehnenzug, der vom M. rectus abdominis herstammt und Verstärkung erhält durch
Faserzüge, welche von der Rectusscheide ablenken. Weitere Stränge biegen vom
lateralen Rande des M. gracilis zum Lig. pubo-femorale ab. Dieses Band verläuft
in einer Rinne an der Unterfläche des horizontalen Schambeinastes etwas gegen die
Incisura acetabuli. Dabei durchsetzt es den M. pubo-femoralis wollen wir den
gewöhnlich Pectineus genannten Muskel des Pferdes bezeichnen und theilt ihn
dabei in einen kleineren, lateralen, tiefer gelegenen Abschnitt und in einen
medialen, stärkeren, oberflächlichen [Fig. 18 u. 19]. Es giebt bei seinem
Durchtritt einigen Fasern des M. pubo-femoralis den Ursprungsort ab. Lateral
von diesem Muskel tritt das Band unter dem Ligamentum transversum in das Gelenk
ein zwischen Lig. teres und Gelenkkopf. Mit dem Ligamentum teres tauscht es
einige Faserzüge aus und inserirt von diesem bedeckt in der Fossa capitis. Das
Ligamentum pubo-femorale benutzt zu seinem Eintritt die vordere seichtere
Hälfte der Incisura acetabuli in der Nachbarschaft des Labium anterius. Die
hintere tiefere Hälfte der Incisura wird von fetthaltigem Bindegewebe
eingenommen, in dessen Schutz A. und V. acetabuli in das Gelenk eintreten [Fig.
19]. Diese Gefässe scheinen übrigens allein für die Fossa acetabuli und die
Synovialhaut bestimmt zu sein; denn in der macerirten Fossa capitis erkennt man
keine Gefässlöcher. Wohl aber trifft man eine Gruppe solcher direct unterhalb
der Fossa capitis am Rande des Kopfes.
1) The ligamentum teres and his uses. Brit. med. Journ. 1882 S. 1036.
2)
Handbuch der vergl. Anatomie der Haussäugethiere 1890 S. 203.
Das
auf die beschriebene Weise zusammengesetzte Ligamentum teres des Pferdes ist
sehr kurz und beschränkt die Rotation und Abduction erheblich, während es auf
Beugung und Streckung keinen Einfluss ausübt. Das Ligamentum pubo-femorale fand
ich schon deutlich ausgebildet beim Pferdefoetus von 12,5 cm. Das Ligamentum
teres durchzieht in diesem Stadium völlig frei das Gelenk.
Wir
müssen noch kurz auf das eigenthümliche Verhalten des Ligamentum pubo - femorale
zum gleichnamigen Muskel eingehen, weil SUTTON (1) auf dieses Verhalten
wesentlich seine Auffassung des Ligamentum feres stützt. SUTTON hält nämlich
diesen Muskel für ein Analogon des M. ambiens der Reptilien und Vögel und das
Band für die eigentliche Ursprungssehne des Muskels, welche vom Caput femoris
herkomme und von der auch noch beim Pferde ein Theil dieses Muskels entspringe.
Nun haben wir aber gesehen, dass dieses Band hauptsächlich vom M. rectus
abdominis herstammt und nur wenigen Fasern des M. pubo-femoralis zum Ursprung
dient, wie auch der laterale Abschnitt des M. gracilis von ihm entspringt. Der
M. pubo-femoralis entspringt dagegen dem horizontalen Schambeinast. Auch GADOW,
(2) auf den SUTTON wegen des M. ambiens sich beruft, betont ausdrücklich: "Gebilde,
die einem typischen M. ambiens homolog wären, fehlen beim Menschen und bei den
Urodelen", und in seinem englischen Referate sagt er wörtlich: „In many
birds and in mammals the ambiens muscle has actually disappeared," (3)
während er umgekehrt den M. pectineus des Menschen einem Theile des M.
pubo-ischio-femoralis internus gleichsetzt. Aber der M. pectineus
(pubo-femoralis) des Pferdes ist nicht einmal dem des Menschen völlig homolog.
1)
Journal of Anatomy and Physiology Vol. XVIII S. 191-193.
2)
Beiträge zur Anatomie der hinteren Extremität der Reptilien. Morph. Jahrb. 1882
S. 378 u. 458.
3)
Observations in Comparative Myology. Journal of Anat. and Phys. Vol. XVI S. 493.
Wir
haben oben gesehen, dass beim Pferde dieser Muskel durch das Ligamentum
pubo-femorale in zwei Abtheilungen zerlegt wird. Diese beiden Abtheilungen
werden aber verschieden innervirt. Die oberflächliche grössere Partie wird vom
N. cruralis, die kleinere tiefere vom N. obturatorius versorgt. Beim Menschen
wird der M. pectineus constant von N. cruralis innervirt, erhält aber
ausnahmsweise auch einen Ast von N. obturatorius. In letzterem Falle kann man
den M. pectineus in zwei Köpfe zerlegen und nachweisen, dass der vom
Obturatorius versorgte eine abgesprengte Partie des M. adductor longus
darstellt. Da beim Pferde ein M. adductor longus fehlt, so muss man annehmen,
dass bei ihm der M. adductor longus und der M. pectineus zusammengeflossen
sind. Zu einem ähnlichen Resultate kommt auch der neueste Autor über diesen
Gegenstand, PATERSON. (1) Wie dem auch sein mag, glaube ich nachgewiesen zu
haben, dass M. pectineus und ambiens keine Homologa sind. Ich würde auf diese
Streitfrage nicht näher eingegangen sein, wenn wir nicht später darauf
zurückkommen müssten.
Aehnliche
Verhältnisse wie beim Pferde scheinen auch beim Esel vorzuliegen. Leider konnte
ich nur ein Skelet untersuchen. Die Pfanne mit Incisura und Fossa acetabuli,
die Rinne am Schambein, die Grube am Schenkelkopf sind dem Pferde so ähnlich,
dass sicher auch das Ligamentum teres bei beiden Thieren sich gleicht.
3.
Seehund. Von den englischen Autoren OWEN, (2) SAVORY, (3) SUTTON, (4) HUMPHRY, (5)
wird dem Seehund ein Ligamentum teres abgesprochen, während er nach HYRTL (6)
ein solches als in das Gelenk vorspringende Falte besitzt. Bei Phoca vitulina
schaut die Hüftgelenkpfanne direct lateralwärts. Die Incisura acetabuli ist
klein, die Fossa seicht, aber ziemlich gross. Der Schenkelkopf (Fig. 14) ist
halbkuglig und sitzt auf einem nur kurzen, wenig entwickelten Halse; die Fossa
capitis liegt excentrisch am Innenrande des Kopfes, wo sie eine seichte
Einbuchtung darstellt. Das Ligamentum teres erwähnt zuerst LUCAE (7) mit
folgenden Worten: "Ein Ligamentum teres steigt als Fortsetzung (der
Kapsel) durch die Incisura acetabuli an der unteren Seite des Gelenkkopfes
hinauf bis zu dessen Mitte, ohne dass in dem Kopfe selbst sich eine Fossa
kundgiebt." WELCKER, (8) der diese Verhältnisse beim jungen und
erwachsenen Seehunde genauer untersuchte, kam zu folgenden Ergebnissen. Das
Ligamentum teres entspringt von der Incisura acetabuli und dem Ligamentum
transversum und zieht als mit der Kapsel in Verbindung bleibende Falte von
mässiger Höhe zum Kopfe und zwar hat es an seinem femoralen Ende eine etwas
grössere Breite und besitzt dort einen gerundeten etwas verdickten freien Rand.
Auch ich fand Aehnliches an einem mit Bändern versehenen Skelet. Es ist demnach
das faltenförmige Ligamentum teres bei Phoca als Regel zu betrachten. Die
entgegengesetzte Angabe der Engländer ist wohl so zu erklären, dass sie an macerirten
Knochen untersuchten und dabei die kleine Grube am Rande der Gelenkfläche des
Schenkelkopfes übersahen. Bei einem Exemplar von Halichoerus sah ich am Knochen
die einspringende Bucht, welche dem Ansatze des Ligamentum teres entspricht,
noch viel deutlicher als bei Phoca.
1)
The pectineus muscle and its nerve-supply. Journal of Anat. and Phys. Oct. 1891
S. 43.
2)
On the osteology of the Chimpanzee and Orang S. 365 f.
3)
On the ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. VIII S. 293.
4)
The nature of Ligaments. Journal of Anat. and Phys. Vol. XX S. 52.
5)
On the human skeleton S. 521.
6)
Topographische Anatomie Bd. II S. 607.
7)
Die Robbe und die Otter. Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden
Gesellschaft Bd. VIII S. 359.
8) Zur
Einwanderung der Bicepssehne. Arch. f. Anat. u. Entw. Bd. III S. 231 ff.
An
Phoca schliesst sich wohl Trichechus an. Auch hier wird das Fehlen des Bandes
angegeben (HYRTL, (1) SAVORY, (2) SUTTON. (3)) Dagegen führt LUCAE (4) an, dass
"sowohl in dem Becken, als auch im Ober- und Unterschenkel fast eine
vollkommene Uebereinstimmung rücksichtlich der Bildung und allgemeinen
Grössenverhältnisse (zwischen Phoca und Trichechus) besteht." Er giebt
zwar nicht das Vorhandensein einer ähnlichen Fossa capitis wie bei Phoca
ausdrücklich an, aber ich glaube, man darf den negativen Schluss ziehen, dass
er das Fehlen der Fossa und des Ligamentum teres, falls es bestünde, sicher
angeführt hätte, da sonst keine vollkommene Uebereinstimmung herrschen würde.
Ich konnte leider kein Skelet von Trichechus untersuchen, bin aber überzeugt,
dass man auch hier eine wandständige Fossa capitis finden wird. Ebenso konnte
ich kein Skelet von Otaria ansehen.
1)
Beiträge zur angewandten Anatomie des Hüftgelenks. Zeitschrift d. Wiener Aerzte
1846 S. 58.
2)
Journal of Anatomy and Physiology Vol. VIII.
3)
Journal of Anatomy and Physiology Vol. XX.
4)
Die Robbe und Otter S. 371.
Es
ist hier der Ort, noch einiger Thiere zu gedenken, die zwar mit den Robben
nicht nahe verwandt sind, ihnen aber doch in Bezug auf Lebensweise gleichen.
Ich meine die Ottern (Lutra und Enhydris). Für die See otter, Enhydris, wird
das Fehlen des runden Bandes von SAVORY und SUTTON angegeben. Der letztgenannte
Autor sagt, er habe Gelegenheit gehabt, zwei frische Exemplare der Seeotter zu
untersuchen und habe kein Band gefunden. In der That besitzt Enhydris eine sehr
enge Incisura und eine nur kleine Fossa acetabuli. Das Femur hat in seiner
plumpen Gestalt noch grosse Aehnlichkeit mit dem von Phoca und Trichechus. Der
Hals ist wenig entwickelt, der Kopf halbkugelig und zeigt von einer Fossa, auch
einer wandständigen, keine Spur. Es wird demnach wohl das Ligamentum teres bei
diesem Thiere fehlen. Weiter entfernt sich von Phoca die Fischotter, Lutra
vulgaris, von der ich ein neugeborenes und ein fast ausgewachsenes Exemplar
untersuchen konnte. Die halbkugelige Gelenkpfanne schaut fast direct nach
aussen. An ihrem medioventralen Umfange liegt die Incisura acetabuli, welche in
die Fossa acetabuli führt. Letztere ist im Verhältniss zur Gelenkfläche noch
klein, dagegen die Incisura auffallend breit. Das Femur gleicht bei Lutra sehr
der bekannten Form (Fig. 15). Der halbkugelige Kopf ist durch. einen deutlich
ausgebildeten Hals mit dem Schafte verbunden. Die gut ausgeprägte Fossa capitis
liegt excentrisch am inneren Umfang des Kopfes als eine am Rande einspringende
Bucht. Das Ligamentum teres (Fig. 17) entspringt mit zwei kräftigen Schenkeln
von den beiden Lippen der Incisura acetabuli. Zwischen beiden Schenkeln liegt
eine dünnere Bindegewebsmembran. An seinem Ursprung ist das runde Band fast 8
mm breit. Es ist durch eine mesenterialartige Duplicatur mit der Innenfläche
der Kapsel verbunden. Während ihres Verlaufs zum Kopfe wird die Falte des
Ligamentum teres schmäler, springt aber weiter in das Gelenk vor. In der Nähe
der Fossa capitis ist das Band noch 3 mm breit, die Höhe der Falte beträgt am
Kopfe reichlich 5 mm. Die Synovialduplicatur ist in der Nähe des Kopfes
bedeutend dünner als weiter peripher. Die Länge des hinteren Schenkels des
Ligamentum teres beträgt 10 mm, die des vorderen etwas mehr. Dies sind die
Verhältnisse beim fast ausgewachsenen Thier. Bei dem neugeborenen Otter ist das
Band ebenso zusammengesetzt wie bei dem erwachsenen. Nur fällt die Kürze und
Breite desselben auf. Die Breite beträgt 2,3 cm bei einem Durchmesser des
Gelenkkopfes von 5,5 mm, während beim erwachsenen Thier die entsprechenden
Maasse 3,6 mm und 12,6 mm sind. Die ausgiebigste Bewegung im Gelenk ist die
Abduction und Adduction nach LUCAE (1) = 135°, während die Excursion für
Beugung und Streckung 112, für die Rotation 90°-100° beträgt. Bei Phoca ist Ab-
und Adduction 106°, Beugung und Rotation = je 60°.
4.
Igel: Die Gelenkpfanne ist mit Einschluss des sie rings umgebenden Limbus
cartilagineus etwas grösser als eine Halbkugel. Der Knochenrand ist durch die
Incisura acetabuli unterbrochen, die sich in die bis zur Mitte der Pfanne
reichende Fossa acetabuli fortsetzt. Die Incisur ist vom Ligamentum transversum
überbrückt. In der Fossa acetabuli liegt fett- und gefässreiches Bindgewebe.
Das Caput femoris stellt gleichfalls einen Abschnitt einer Kugel dar. Es ist
durch den in stumpfem Winkel vom Schafte abgehenden Hals mit letzterem
verbunden. Die Oberfläche des Kopfes ist vollkommen glatt; nur in ihrem Centrum
sieht oder fühlt man gelegentlich eine ganz kleine rauhe Stelle oder ein Höckerchen.
Der Schenkelkopf überragt den Trochanter major etwas. Ein Ligamentum teres
besteht beim Igel nicht, wie dies auch schon GEGENBAUR (2) und LECHE (3)
angegeben. Auch ich fand bei mehreren intacten Exemplaren, die ich untersuchte,
keine Spur eines Bandes.
1)
Die Robbe und Otter.
2)
Ueber den Ausschluss des Schambeins von der Pfanne des Hüftgelenks. Morph.
Jahrb. Bd. II 1870 S. 232.
3)
Zur Anatomie der Beckenregion der Insectivoren. Konliga svenska
vetenskaps-akademiens handlingar 1882/83 Nr. 4 S. 12.
Nur
ein noch nicht völlig erwachsener weiblicher Igel machte eine Ausnahme davon.
Auch hier war Gelenkkopf und Pfanne wie oben beschrieben. Auf das Gewebe der
Fossa acetabuli aufgelagert fand sich jedoch ein 1 mm breiter, 4,5 mm langer
bindegewebiger Strang, der an der Incisura acetabuli entsprang und frei endete.
Am Kopfe zeigte sich das erwähnte Höckerchen deutlicher ausgebildet. Auf beiden
Seiten war der Befund derselbe. Offenbar haben wir es hier mit einem Ligamentum
teres zu thun, das normalen Ursprung und richtige Lage besitzt, aber mit dem
Kopfe nicht mehr in Verbindung steht. Noch auffallender aber ist die Thatsache,
die ich am Igelfoetus feststellen konnte. Ich hatte das Glück zwei Igelfoeten
von 45 mm. Steiss-Schnauzenlänge zu untersuchen. In den Gelenken derselben
gelang es mir sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch an Serienschnitten
ein vollentwickeltes Ligamentum teres zu entdecken, welches im Centrum des
Schenkelkopfes inserirte (Fig. 5). – Im Anschluss an den Igel mögen hier noch
einige andere Insectivoren erwähnt werden, da sie vielleicht zur Lösung der uns
gestellten Aufgabe beitragen können. Centetes ecaudatus bietet in Hinsicht auf
Pfanne und Kopf vollständige Uebereinstimmung mit dem Igel, nur besitzt er ein
kräftig entwickeltes Ligamentum teres von ausgesprochen dreieckiger Gestalt.
Dasselbe inserirt zugespitzt, aber kräftig, fast im Centrum des Kopfes. Sorex
vulgaris hat ebenfalls eine kugelige Gelenkpfanne und einen entsprechenden Kopf
mit central inserirendem, verhältnissmässig kräftigem Ligamentum teres.
Eigenthümliche Verhältnisse treffen wir dagegen bei dem Maulwurf, Talpa
europaea. Hier hat die Pfanne nicht die gewöhnliche Halbkugelform, sondern
setzt sich vorn und hinten etwas weiter, aber mit verminderter Krümmung über
den Kopf fort. Am oberen Rande dagegen zeigt sie eine seichte, am unteren eine
stärkere Einbuchtung. Letzere entspricht der Incisura acetabuli, welche aber in
keine Fossa führt, da der ganze Boden der Pfanne glatt und knöchern ist. Gemäss
der Gestalt der Pfanne ist auch die Form des Gelenkkopfes, der sich durch einen
nur sehr wenig entwickelten Hals vom Schafte abgliedert, keine kugelige. Sie
gleicht vielmehr einem quergestellten Cylinder oder richtiger Ellipsoid. Der Kopf
ist an seiner oberen, vorderen und hinteren Seite überknorpelt. Lateral
schliesst sich direct der Trochanter major an, an der medialen Seite inserirt
das starke Ligamentum teres. Dieses ist jedoch nicht frei im Gelenk
ausgespannt, sondern stellt eine in das Gelenkinnere. vorspringende Falte der
unteren Kapselwand dar. Es entspringt an den beiden Lippen der Incisura
acetabuli und inserirt am Kopfe in einer Linie, die im Mittelpunkt der medialen
Fläche des Gelenkkopfes beginnt und nach abwärts gegen den Trochanter minor
hinzieht. Wir haben demnach in der kleinen Gruppe der Insectivoren in Bezug auf
das Ligamentum teres die eigenthümlichsten Modificationen. In gewöhnlicher
Weise sehen wir es ausgebildet bei Sorex und Centetes, als in das Gelenk
vorspringende Falte bei Talpa und gänzlich fehlen bei Erinaceus im erwachsenen
Zustande.
Die
nunmehr noch zu besprechenden Thiere lassen sich in drei Gruppen
zusammenstellen. Die eine bilden die Beutelthiere, die zweite Echidna und
Ornithorhynchus und die dritte die Edentaten. Für Macropus giganteus giebt
MECKEL (1) das Fehlen der Fossa capitis an. Leider konnte ich kein frisches
Känguruh untersuchen, dagegen fand ich an mehreren Skeleten, worunter auch
eines von Macropus giganteus war, eine deutliche Incisura und eine auffallend
grosse Fossa acetabuli. Charakteristisch für die Pfanne ist, dass ihr oberer
Rand sehr weit nach aussen greift, so dass die Eingangsebene des Gelenks sehr
geneigt ist. Der halbkugelige Gelenkkopf zeigt von einer Fossa jedenfalls nur
höchst zweifelhafte Reste, wenn überhaupt eine da ist. Es ist dies wieder einer
jener Fälle, wo die Beobachtung am macerirten Knochen nicht ausreicht und
Control untersuchungen am frischen Präparat angestellt werden müssen. Vom
Springhasen konnte ich nicht einmal das Skelet studiren, doch ist anzunehmen,
dass die Verhältnisse denen beim Känguruh ganz ähnlich sind. Bei Perameles und
Didelphys fand ich ein kräftiges Ligamentum teres.
1)
System der vergleichenden Anatomie II. Bd. II. Abth.
Das
Hüftgelenk von Echidna und Ornithorhynchus ist durch das Fehlen einer Incisura
und einer Fossa acetabuli ausgezeichnet. Im einzelnen weisen die Gelenke jedoch
Verschiedenheiten auf, die eine gesonderte Besprechung erfordern. Bei
Ornithorhynchus paradoxus sieht die Pfanne [Fig. 12] direct nach aussen. Der
Femurkopf [Fig. 13] liegt in der directen Verlängerung des Schaftes, medial und
lateral davon stehen die beiden gleichgrossen Trochanteren. Der Kopf ist nicht
ganz eine Halbkugel, das Femur ist in seiner natürlichen Lage ziemlich direct
nach aussen gerichtet. Eine Fossa capitis fehlt. Von Echidna hystrix konnte ich
ein Spirituspräparat untersuchen. Die Pfanne mit dem Limbus cartilagineus ist
nicht ganz halbkugelig, sondern stellt nur ein Kugelsegment dar. Der knöcherne
Pfannenboden besitzt im Centrum eine Oeffnung, welche durch eine Bindegewebsmembran
verschlossen ist. Der Schenkelkopf ist direct in der Axe des Schaftes
angebracht, in der Mitte zwischen den beiden Trochanteren. Es umfasst etwas
mehr als die Hälfte einer Kugel, namentlich deshalb weil die Gelenkfläche sich
nach aussen gegen den Trochanter major fortsetzt. Dagegen ist die Krümmung
nicht so ganz gleichmässig wie bei einer Kugel. Eine Fossa capitis fehlt,
ebenso ist im Gelenke nichts von einem Ligamentum teres zu entdecken. Die
Pfanne umfasst nicht ganz die Hälfte des Kopfes. Das Femur zieht von der Pfanne
in transversaler Richtung nach aussen.
Der
Mangel des Ligamentum teres, der Incisura acetabuli und der Fossa capitis bei
den Monotremen ist schon lange bekannt (MECKEL, OWEN u. A.) OWEN (1) giebt auch
für Echidna setosa das Fehlen des runden Bandes an.
In
Bezug auf die Edentaten sind die Mittheilungen in der Literatur nicht
übereinstimmend. Bradypus sowohl als auch Choloepus besitzen nach
gleichlautenden Angaben kein Ligamentum teres. Cholcepus hat eine ziemlich
direct nach aussen schauende, wenig geneigte Pfanne, eine nur kleine Incisura
und Fossa acetabuli. Der Schenkelkopf ist halbkugelig, median- und
aufwärtsschauend, ein Collum ist nicht vorhanden, der Kopf sitzt auf einer
leichten Ausschweifung des Schaftes nach innen. Bei Myrmecophaga fand ich eine
Fossa capitis. Dasypus besitzt nach WELCKER (2) das Band. Ich traf bei
Dasypus villosus und peba eine Fossa capitis im Zusammenhang mit dem Rande der
Gelenkfläche. Bei Dasypus novemcinctus entdeckte. ich am Spirituspräparate das
Ligamentum teres als eine in das Gelenkinnere vorspringende Falte. Das noch
nicht ausgewachsene, 65 cm lange Thier hatte eine Pfanne, welche hinten oben
ziemlich weit über den Gelenkkopf übergriff, eine Incisura und eine Fossa
acetabuli. Aus letzterer stieg ein kurzes kräftiges Ligamentum teres horizontal
nach aussen zur Innenseite des Gelenkkopfes, wo es in einer halbmondförmigen
Fossa capitis inserirte. Der Gelenkkopf war halbkugelig; nur auf der medialen
Seite wurde die glatte Oberfläche durch die erwähnte Fossa capitis
unterbrochen. Der Kopf befindet sich in directer Fortsetzung des Schaftes, nur
ein klein wenig nach innen abweichend. Er wird von dem sehr kräftigen
Trochanter major überragt. Das Ligamentum teres ist 4 mm breit, 4,5 mm lang und
ebenso hoch. Bei Manis fehlt nach MECKEL (3) die Incisura acetabuli, nach OWEN (1) das Band, während es nach WELCKER 2) vorhanden ist. Ich fand bei Manis
javanica eine sehr kleine Incisura acetabuli, dagegen keine Fossa capitis.
Orycteropus besitzt nach WELCKER (2) das runde Band.
Um
mich mit den einfacheren Gelenkformen bekannt zu machen, untersuchte ich noch
das Hüftgelenk einiger Reptilien, namentlich auch aus dem Grunde, weil SUTTON (4)
das Ligamentum teres mit einem bei den Reptilien vorkommenden Muskel (M.
ambiens) in Verbindung bringt. Ich studirte die Gelenke von Hatteria, Emys und
Alligator. Im allgemeinen fand ich bei allen drei Reptilien ähnliche
Verhältnisse. Bei Hatteria setzt sich die Gelenkpfanne aus allen drei
Beckenknochen gleichmässig zusammen und ist gegen die Beckenhöhle
abgeschlossen. Sie schaut direct lateralwärts und ist nicht halbkugelig,
sondern elliptisch, die Längsaxe parallel der des Rumpfes gerichtet.
1) On the osteology of the Chimpanzee and Orang.
2)
Ueber das Hüftgelenk. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1876.
3)
System der vergleichenden Anatomie Bd. II Abth. II.
4)
The ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. XVII.
Ebenso
ist der Kopf des Femur nicht kugelig, sondern gleicht einem dorso-ventral
plattgedrückten Cylinderabschnitt. Die überknorpelte Fläche verschmälert sich
nach vorn und hinten, so dass sie eigentlich ellipsoid ist. Hinter dem Kopfe
befindet sich an der Grenze gegen den Schaft ein starker Muskelhöcker. Das
Kapselband zeigt sowohl an der dorsalen als auch an der ventralen Seite
Verstärkungsstränge, Lig. accessorium dorsale et ventrale. Jeder derselben
setzt sich wieder aus einem vorderen. und einem hinteren Schenkel zusammen
(Fig. 10). Der vordere Schenkel des ventralen Bandes entspringt dem Processus
lateralis pubis, wo auch die Mm. ambiens und pubi-tibialis (GADOW (1) ihren
Ursprung nehmen. Der hintere Schenkel kommt vom hinteren Ende des Acetabulum
von einem Höckerchen, welches dem Os ischii angehört. Beide Bandstränge convergiren
zu einer kleinen Grube, die unter der Mitte des ventralen Randes der
überknorpelten Gelenkfläche liegt. Die beiden Schenkel des dorsalen Bandes sind
etwas stärker und entspringen etwas näher bei einander, der vordere vom
vorderen, der hintere vom hinteren Ende des pubalen Pfannenumfangs. Ihr
Anheftungspunkt liegt dem des Lig. accessorium ventrale direct gegenüber.
Nach
der soeben gegebenen Beschreibung der Gelenkflächen und Bänder ist das
Hüftgelenk von Hatteria im allgemeinen ein Winkelgelenk. Das Femur ist in
transversaler Richtung vom Becken nach auswärts gerichtet und bewegt sich in
einer horizontalen oder nur schwach geneigten Ebene um eine verticale Axe. Die
Bewegungen sind hauptsächlich Flexion und Extension; Abduction und Adduction,
noch mehr aber Rotation scheint durch die Anordnung des Gelenks ziemlich
ausgeschlossen.
1)
Beiträge zur Myologie der hinteren Extremitäten der Reptilien. Morph. Jahrb.
Bd. VII.
Aehnliches
kann man bei Emys beobachten. Die Pfanne (Fig. 6) ist ausgesprochen dreilappig
mit einer vorderen, hinteren und oberen. Ausladung gemäss den drei Knochen,
welche sie zusammensetzen, und drei Einbuchtungen dazwischen, die den Nähten
zwischen den einzelnen Knochen entsprechen. Die Pfanne ist exquisit
lateralwärts gerichtet; ihre Längsaxe zieht von hinten nach vorn, von der
hinteren Einbuchtung nach der dem Schambein angehörigen Vorwölbung. Hinten ist
die Pfanne auf die hintere und obere Vorwölbung verbreitert, während sie sich
nach vorn zu verschmälert. Der Schenkelkopf (Fig. 7) sitzt auf dem sanft nach
vorn gebogenen Schafte, gegen den er ziemlich scharf abgeknickt ist. In der
Verlängerung des Schaftes liegen hinter dem Kopfe zwei Trochanteren und
zwischen ihnen eine Fossa trochanterica. Die Gelenkfläche ist in der Mitte am
breitesten, spitzt sich aber nach hinten und vorn zu, und zwar nach hinten mehr
als nach vorn. Sie gleicht demnach einem Theil der Oberfläche eines Ovoids. Die
längste Axe dieses Ovoids ist bei natürlicher Stellung des Oberschenkels
parallel zur Körperaxe gerichtet. Das Kapselband ist durch Ligamenta accessoria
verstärkt. Von den beiden Schenkeln des Lig. accessorium ventrale entspringt
der vordere am Os pubis, der hintere am Os ischii. Beide convergiren gegen die
Mitte des ventralen Kopfrandes und inseriren in einem Grübchen, in das ein vom
Trochanter ventralis ausgehendes Leistchen einmündet. Die beiden Schenkel des
Lig. accessorium dorsale sind nicht so scharf getrennt wie bei Hatteria. Der
vordere kommt aus der Incisura iliopubica, der hintere vom Tuberculum iliacum
der Pfanne. Sie inseriren in der Mitte des dorsalen Randes des Gelenkkopfes.
Bei Emys ist durch das Bauch- und Rückenschild die Bewegung noch beschränkter
als bei Hatteria; sie besteht fast nur aus Beugung und Streckung.
Etwas
anders liegen die Verhältnisse beim Alligator. Hier wird die Pfanne nur von
Ilium und Ischium gebildet, die sich je einen hinteren und vorderen Fortsatz
entgegenschicken (Fig. 8). Doch erreichen sich nur die hinteren Fortsätze
vollkommen, während die vorderen durch eine Bandmasse verbunden werden. Der
Grund der Pfanne ist nicht durch Knochen geschlossen wie bei Emys und Hatteria,
sondern durchbrochen wie bei den Vögeln und Echidna. In der Oeffnung ist eine
Membran ausgespannt. Das Femur (Fig. 9) gleicht im allgemeinen dem der Schildkröte,
ist nur weniger gebogen; die Muskelhöcker sind weniger ausgesprochen, überhaupt
die ganze Gestalt schlanker, eleganter. Der Kopf stellt einen Theil eines
dorso-ventral comprimirten Cylinders dar, der vorn mit seiner Wölbung etwas
über den Schaft hinausreicht. Die Ligg. accessoria inseriren in der Mitte der
plattgedrückten Seiten des Kopfes. Das ventrale setzt sich aus zwei Schenkeln
zusammen (Fig. 11), von denen der vordere, bedeutend stärkere, von der
Bandmasse zwischen Ilium und Ischium entspringt, der hintere von Limbus
cartilagineus in der Nähe des hinteren Endes der Pfanne. Die beiden Schenkel
des dorsalen Bandes sind kräftiger als die des ventralen. Der vordere
entspringt breit vom vorderen Theil des iliacalen Pfannentheils und steigt, sich
etwas zuspitzend, nach hinten abwärts zu einer kleinen Grube in der Mitte des
lateralen Umfanges des Kopfes. Er deckt an seinem Ursprung den vorderen
Abschnitt des hinteren Schenkels, an der Insertion den ganzen hinteren
Schenkel. Letzterer entspringt vom hinteren Abschnitt des iliacalen
Pfannentheils und setzt sich mit seinem hinteren Rande in eine Art Labrum
cartilagineum fort, das die Pfanne ergänzt. Er inserirt in der erwähnten Grube
unter dem vorderen Schenkel verborgen. Das Lig. access. dorsale zieht von vorn
nach hinten und von innen nach aussen, ist deshalb ein Hemmungsband für
Rotation nach hinten und für Adduction bei gestrecktem Schenkel. Dagegen ist
bei rechtwinklig abstehendem oder mässig gebeugtem Femur eine Adduction wohl
möglich, und man sieht dabei deutlich, wie bei dieser Bewegung das Lig. access.
ventrale durch seinen
Ansatzpunkt
in das Gelenkinnere nachgeschleift wird. Nach der Anordnung der Gelenkflächen
und der Muskeln sind auch beim Alligator Beugung und Streckung die
Hauptbewegungen, daneben ist aber auch Abduction und Adduction möglich, während
Rotationsbewegungen ziemlich unmöglich sind.
Vergleichung.
Wir
haben nunmehr die Hüftgelenke der Säugethiere untersucht, soweit sie in
Beziehung auf das Ligamentum teres eine Besonderheit darbieten, d. h. solche,
in denen das Band entweder als Falte auftrat, rudimentär entwickelt war oder
ganz fehlte. Denn von hier aus erschien es mir am ehesten möglich, eine
genügende Erklärung für die Bedeutung des gewöhnlichen Verhaltens zu erhalten.
Daran schloss sich die Schilderung der einfacheren Formen des Hüftgelenkes, wie
sie bei den Reptilien vorkommen, um einen bestimmten Ausganspunkt für die
Vergleichung zu gewinnen. Die Vögel liess ich absichtlich ausserhalb meiner
Betrachtungen, einmal weil mir kein hinreichendes Material geboten war, sodann
aber hauptsächlich weil diese doch wiederum eine ganz besondere
Entwicklungsreihe darstellen. Hier sei nur ganz im allgemeinen bemerkt, dass in
der Regel ein Ligamentum teres vorhanden ist, welches am unteren Umfange der
Pfannenöffnung entspringt und horizontal nach aussen zum Centrum des
Schenkelkopfes zieht. Doch scheinen auch bei den Vögeln manche Variationen
vorzukommen. Denn während z. B. der Strauss eine ausserordentlich tiefe Fossa
capitis besitzt, konnte ich bei Rhea, beim Emu und Casuar keine entdecken.
Im
Grossen und Ganzen kann man, glaube ich, von den Reptilien zur Reihe der
Säugethiere und zum Menschen folgenden Gang der Entwicklung annehmen. Bei den
Reptilien ist das Hüftgelenk der Hauptsache nach ein Winkelgelenk mit einer
flachen Pfanne und einem mehr oder weniger cylindrischen Gelenkkopf. Die
Längsaxe von Pfanne und Gelenk ist der Körperaxe parallel gestellt. Das Femur
steht rechtwinklig nach aussen vom Rumpfe ab. Die Drehungsaxe des Gelenkes ist vertical
und ihr dorsaler und ventraler Endpunkt wie gewöhnlich in Ginglymusgelenken,
durch Seitenbänder verstärkt. Die Bewegungen beschränken sich im allgemeinen
auf Beugung und Streckung, wobei sich das Femur in einer horizontalen, nach
aussen etwas abfallenden Ebene bewegt. Bei den Schildkröten ist durch Bauch-
und Rückenschild jede andere Bewegung ausgeschlossen, während bei Alligator
verhältnissmässig ausgiebige Ab- und Adduction möglich ist. Diese Beweglichkeit
ist mit dem Reichthum an Bewegungen, wie ihn das Hüftgelenk der Säugethiere,
speciell der Raubthiere bietet, natürlich gar nicht zu vergleichen.
Mit
der Umwandlung des Winkelgelenks der Reptilien in das Kugelgelenk der
Säugethiere und mit der dadurch bedingten Zunahme der Bewegungsfreiheit ist auch
das Auftreten des Ligamentum teres verbunden. Diese Umwandlung stelle ich mir
folgendermassen vor. Zuerst erfolgt die Adduction des Femur. Es sind dann im
Gelenke Bewegungen um zwei senkrecht zu einander stehende Axen möglich, indem
zu der bei den Reptilien vorherrschenden Beugung und Streckung noch Abduction
und Adduction hinzukommen. Damit ist aber nothwendigerweise eine Umänderung der
Gelenkflächen verbunden, die sich schon mehr oder weniger der Kugelform nähern
müssen. Mit der Adduction rücken bisher ausserhalb der Pfanne gelegene
Abschnitte des Schenkelkopfes in diese ein und werden mit zur Gelenkfläche
benutzt. Es sind dies die Partien, welche der ventralen Randfläche des bisher
cylindrischen Gelenkkopfes zunächst lagen, d. h. die ventralen Ansätze der
Kapsel speciell des Lig. accessorium ventrale. Der Insertionspunkt des Bandes
rückt in das Gelenk und schleift so das Band selbst nach. Nur die vor und
hinter der Anheftungsstelle des Bandes gelegenen Theile, wo das Kapselband von
vornherein etwas tiefer inserirte und dünner war, werden zur Vergrösserung des
Gelenkkopfes verwendet. Das Lig. accessorium ventrale oder mediale, wie es
jetzt genannt werden muss, bildet so eine in das Gelenk vorspringende Falte,
die durch eine Duplicatur der Synovialhaut mit der Kapsel in Verbindung steht.
So lange Beugung und Streckung sowie Ab- und Adduction die Hauptbewegungen im
Gelenke sind, wird das Band sich nicht weiter verändern. Tritt jedoch die
Thätigkeit ausgiebiger Rotationsbewegungen hinzu, so wird der Kopf sich unter
dem Bande zu verschieben versuchen und schliesslich die Synovialduplicatur, die
das Band mit der Kapsel und dem unterhalb der Fossa capitis befindlichen Theil
des Kopfes verbindet, lösen. Dies ist das Stadium des freien Ligamentum teres,
wie wir es bei der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Säugethiere kennen.
Schliesslich kann aber auch der Ansatz des Bandes am Kopfe schwinden und sogar
der in der Pfanne liegende Rest des Bandes der Resorption anheimfallen. Auf
diese Weise sind einige Fälle von Fehlen des Ligamentum teres zu erklären, wie
wir bald sehen werden.
Mit
dem Einwandern des Lig. accessorium ventrale in das Gelenk sind aber auch
Umwandlungen der Pfanne verbunden. Im Allgemeinen behält ja die Pfanne ihre
ursprüngliche Lage und Richtung nach aussen auch bei den Säugethieren bei, nur
ein wenig neigt sich ihre Ebene zum Horizont. Mit der Adduction des Femur und
der Umwandlung seines Kopfes zur Kugel muss jedoch auch eine entsprechende
Modification der Pfanne einhergehen. Da aber, wie gesagt, die Lage der Pfanne
im Ganzen dieselbe bleibt, müssen Theile, die bisher unter ihr lagen,
angeschliffen werden. Auch hier werden nur Partien, die vor oder hinter dem
Ursprung des Ligamentum accessorium (teres) lagen, zur Vergrösserung der
Gelenkfläche benutzt, während das Band selbst dazwischen eine Furche erzeugt
(Incisura und Fossa acetabuli). Die Gelenkfläche erhält so statt der Kugel-
eine Ringform, die sich auch. dann noch erhält, wenn das Ligamentum teres der
Resorption anheimfällt.
Ausser
der eben beschriebenen giebt es jedoch noch eine zweite Möglichkeit der
Umbildung des Hüftgelenks. Während bei dem geschilderten Vorgang Pfanne und
Gelenkkopf die ursprünglichen Lagebeziehungen zu einander ändern, indem mit der
fortschreitenden Adduction neue Partien der medialen Seite des Kopfes in das
Gelenk einbezogen werden und die Pfanne sich an ihrem unteren Umfange weiter
bildet, können Pfanne und Kopf bei erfolgender Adduction ihre Beziehungen auch
beibehalten. Es wird aber in diesem Falle nach Vollendung der Adduction die
Pfanne anders aussehen als im ersten. Denn statt auswärts wird jetzt die Pfanne
nach abwärts gerichtet sein: die Kugelgestalt ist durch Vergrösserung nach der
lateralen Seite erreicht. Der Gelenkkopf sitzt nicht wie im ersten Falle an der
medialen Seite des Femurschaftes, mit ihm durch einen mehr oder minder
ausgeprägten Hals verbunden, sondern er liegt in direkter Verlängerung der
Diaphyse. Zur Einwanderung des Ligamentum accessorium. mediale und Entwicklung
eines Ligamentum teres wird es unter diesen Umständen gar nicht oder nur in
ganz geringem Grade kommen. Auf diese Weise entsteht auch eine Hüftgelenk ohne
Ligamentum teres, aber auch ohne Incisura und Fossa acetabuli. Dieser
Bildungsmodus ist also dem erstgenannten geradezu entgegengesetzt.
Für
die beiden soeben geschilderten Arten der Umformung des Hüftgelenks finden wir
in der That Vertreter unter den Säugethieren. Am einfachsten liegen die
Verhältnisse bei den Monotremen. Die Pfanne schaut nach aussen und etwas
abwärts. Das Femur steht ziemlich transversal vom Becken ab, der Kopf liegt in
der Verlängerung des Schaftes. Die ganze Anordnung nähert sich demnach noch
sehr der der Reptilien. Es ist ein indifferentes Stadium, von dem aus. die
Entwickelung sowohl nach der einen als auch nach der anderen Seite ausgehen
kann. Hier fehlt natürlich noch eine Incisura acetabuli und ein Ligamentum
teres.
Die
erste Reihe der Entwicklung erkennen wir bei der Vergleichung der Hüftgelenke
von Seehund, Fischotter und Dachs (Fig. 14, 15 und 16) oder sonst einem Raubthier.
Bei Phoca steht das Femur fast rechtwinklig vom Rumpf ab, der Schenkelkopf
liegt fast direct in der Längsaxe des Knochens. Die Hauptbewegung des Gelenkes
beim Schwimmen ist die Ab- und Adduction, die nach LUCAE (1) 106° beträgt,
während Flexion und Extension sowie Rotation nur in einer Ausdehnung von 60°
möglich sind. Obwohl aber hier die Stellung des Femur zum Rumpf noch
rechwinklig ist, treffen wir doch eine kleine Incisura acetabuli und ein, wenn
auch gering entwickeltes und wandständiges Ligamentum teres, welches offenbar
einen durch die Ab- und Adductionsbewegungen in das Gelenk einbezogenen Theil
der Kapsel darstellt. Der Gelenkkopf ist trotzdem rund, weil eben neben dieser
Hauptbewegung auch noch andere Bewegungen im Gelenke möglich sind. Einen
Schritt weiter sehen wir alle diese Veränderungen bei der Fischotter
entwickelt. Femur und Pfanne bieten hier schon fast die gewöhnlichen Formen.
Incisura und Fossa acetabuli, Collum femoris, alles ist deutlich entwickelt.
Das Ligamentum teres ist kräftig ausgebildet, aber noch wandständig und springt
erheblich in das Gelenk vor. Die Fossa capitis steht nicht in directem
Zusammenhang mit dem Rande der Gelenkfläche, sondern durch eine
Synovialduplicatur, welche von ihr zur Kapsel zieht. Diese Synovialduplicatur,
welche den Zusammenhang des Bandes mit der Kapsel vermittelt, wird je näher sie
der Insersionsstelle des Bandes kommt, desto höher und dünner, zuletzt ganz
transparent. Die Bewegungen sind bei Lutra viel freier als hei Phoca, doch
bestehen sie auch hier noch infolge der Schwimmbewegung hauptsächlich in Ab-
und Adduction. Bei den auf dem Lande lebenden Raubthieren, bei welchen
Bewegungen um alle drei Axen des Femur gleichmässig stattfinden, ist der
Zusammenhang des Ligamentum teres mit der Kapsel und der Oberfläche des Kopfes
bis zur Insertionsstelle in der Fossa gelöst und das Band frei.
1)
Die Robbe und Otter 1872.
Beispiele
der zweiten Entwicklungsreihe des Hüftgelenks und des Ligamentum teres hat uns
zum Theil schon WELCKER (1) geliefert. Ein Hüftgelenk mit horizontal stehenden
Gelenkflächen und vertikal in der Axe des Femur aufstrebendem Gelenkkopfe
treffen wir beim Nilpferd. (Auch für das Megatherium wird dasselbe behauptet.)
Hier fehlt Incisura. und Fossa acetabuli und Fossa capitis. Es sind hier eben
die lateralen. Partien des Kopfes und der Pfanne zur Umbildung des Gelenkes
benutzt werden. Aber auch diese Formen sind durch Uebergänge mit den
gewöhnlichen verbunden. Bei Elephant und Nashorn tritt schon eine Andeutung
einer Incisura acetabuli auf; Fossa acetabuli sowohl wie capitis fehlt dagegen
noch; die Gelenkflächen sind stark gegen den Horizont gesenkt. Hyrax scheint
dagegen schon ein wandständiges Ligamentum teres zu besitzen. Der Tapir hat
nach WELCKER (1. c.) im jugendlichen Stadium ein wandständiges Ligamentum
teres, während beim erwachsenen Thiere das Band frei ist. Der Tapir steht in
der ganzen Gelenkbildung den eben beschriebenen Thieren noch sehr nahe, da die
Pfanne eine grosse Neigung, das Femur einen nur wenig ausgebildeten Hals zeigt,
leitet aber doch schon zum Pferde über, das zwar noch ein sehr seitlich
inserirendes, aber trotzdem schon im Foetalzustande freies Ligamentum teres
erkennen lässt, während die Gelenkpfanne schräg nach aussen sieht. Ueber den
eigenthümlichen Verstärkungsstrang des runden Bandes beim Pferde kann ich
leider nur mittheilen, dass ich ihn schon beim Foetus vollentwickelt, in
charakteristischer Lage angetroffen habe. Er scheint mir auf einen Muskel zu
weisen, der einst vom Bauch herab zum Oberschenkel zog.
1)
Ueber das Hüftgelenk. Zeitschrift f. Anat. u. Entw. 1876.
Leider
war es mir unmöglich, irgend einen Verwandten des Pferdes in frischem Zustande
zu untersuchen und so vielleicht Aufschluss über dieses räthselhafte Gebilde zu
erlangen. Denn dass es nicht, wie SUTTON (1) meint, der Sehne des M. ambiens
entspricht, habe ich schon früher nachgewiesen.
1)
The ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. XVII.
In
der Gruppe der Insectivoren treffen wir Vertreter aller Modificationen des
Ligamentum teres, ein wandständiges mit analoger Bildung des Gelenks bei Talpa,
ein freies bei Sorex und Centetes. Der Igel besitzt kein rundes Band. Doch
lässt sich sein Mangel hier nicht auf dieselbe Weise wie bei den bisher
erwähnten Thieren erklären. Denn der Igel hat eine deutliche Incisura und Fossa
acetabuli, was bei Echidna, Ornithorhynchus und Nilpferd nicht der Fall ist.
Auch habe ich schon früher erwähnt, dass ich in einem Falle in der Fossa
acetabuli einen bindegewebigen Strang fand, der ganz einem Ligamentum teres
glich, aber nicht mit dem Kopfe in Verbindung stand. In der Mitte der
Oberfläche des Gelenkkopfes traf ich ein kleines Höckerchen, das ganz gut als
Insertionsstelle des in der Fossa acetabuli liegenden Bandes betrachtet werden
konnte. Lag nach diesem Befund schon der Gedanke nahe, den Mangel des
Ligamentum teres beim Igel durch Resorption zu erklären, so wurde er durch die
Untersuchung in foetalem Zustande bestätigt. Ich fand, wie schon erwähnt, in den
Gelenken von zwei Igelfoeten von 45 mm Länge, bei denen gerade die
Verknöcherung im Oberschenkel begann, während die Beckenknochen noch ganz
knorpelig waren, ein wohl ausgebildetes, am Kopfe central inserirendes
Ligamentum teres (Fig. 5). Die Gelenkspalte ist um diese Zeit schon vollständig
gebildet und Kopf und Pfanne stellen schon ein verkleinertes Abbild ihres
entwickelten Zustandes dar. Wann hier das Band schwindet, kann ich nicht
angeben, da mir ältere Foeten sowie jugendliche Exemplare von Igel nicht zu
Gebote standen. Jedenfalls aber steht die Thatsache fest, dass das Ligamentum
teres beim Igel angelegt wird. Es erklärt sich damit die bisher völlig dunkle
Thatsache eines Mangels des runden Bandes beim Igel einfach als Schwund eines.
im foetalen Zustande vorhandenen Organs. Die Monotremen einerseits, der Igel
andrerseits bilden daher die Pole der phylogenetischen Entwicklungsreihe des
runden Bandes. Bei jenen ist es noch nicht zur Einbeziehung eines Ligamentum
teres in das Gelenk gekommen, beim Igel wird der durch seine Einwanderung in
das Gelenk bedeutungslos gewordene ehemalige Kapselabschnitt zwar noch
angelegt, schwindet aber im Laufe der Entwicklung wieder, so dass in der Regel
beim erwachsenen Thiere von einem Ligamentum teres nichts nachzuweisen ist. Das
wandständige Ligamentum teres von Talpa und das freie von Sorex sind
Uebergangsstufen zwischen diesen beiden Extremen. Also auch in Bezug auf das
Ligamentum teres und das ganze Hüftgelenk zeigt sich wie so vielfach sonst die
eigenthümliche centrale Stellung der Insectivoren unter den Säugethieren, die
nach den verschiedensten. Gruppen überleitet.
In
der That halte ich die Ergebnisse bei der Untersuchung des Igels einer
allgemeineren Anwendung fähig und glaube, dass noch bei verschiedenen Thieren
das Fehlen des Ligamentum teres auf diese Weise als Rückbildung zu deuten ist.
Hierher gehört vor allem der Orang Utan, bei dem das Fehlen des runden Bandes
bisher sehr auffallend erscheinen musste, da es die übrigen Anthropoiden
besitzen. Ich habe schon oben mehrere Angaben in der Literatur
zusammengestellt, die ein gelegentliches Vorkommen des Bandes beim Orang, wie
auch ein ausnahmsweises Fehlen bei den anderen Anthropoiden berichten. Diese Thatsachen
mussten noch sonderbarer" erscheinen, wie dies WELCKER (1) ganz richtig
bemerkt. Nachdem wir aber erkannt haben, wie das Fehlen beim Igel zu erklären
ist, ist uns auch das Verhalten bei den Anthropoiden verständlich geworden.
Beim Orang wird wie beim Igel das Band gewöhnlich nicht mehr zur Ausbildung
gelangen, wohl aber noch angelegt werden. Dafür spricht wenigstens sein
gelegentliches Vorhandensein beim erwachsenen Thiere. Und was beim Orang als
Regel auftritt, scheint bei den übrigen Anthropoiden hie und da als Ausnahme
vorzukommen.
1)
Ueber das Hüftgelenk. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1876.
Es
bleibt jetzt noch eine Reihe von Thieren mit Fehlen des Ligamentum teres übrig,
bei denen ich nicht bestimmt aussprechen kann, wie dies zu erklären ist.
Wahrscheinlich gehören sie alle dem Igeltypus an. Am sichersten gilt dies von
Enhydris, wo auch eine ganz kleine Incisura acetabuli, aber keine Fossa capitis
vorhanden ist. Für die Springbeutler erklärte ich schon früher die
Schwierigkeiten, die die Untersuchung des Skelets darbietet. Ueber die
Edentaten herrschen Widersprüche in der Literatur, die ich durch meine
Untersuchungen nicht völlig aufklären konnte. Vielleicht sind sie nur scheinbar
und so zu deuten, dass bei einigen Edentaten das runde Band immer, bei anderen
gelegentlich fehlt. Hier müssen weitere Untersuchungen an möglichst frischem
Material die Lücke ausfüllen. Bei Dasypus novemcinctus fand ich, wie erwähnt,
das Band als Falte.
Viel
wichtiger scheint mir jedoch die Mittheilung einer Reihe von Thatsachen, die
das gar nicht allzu seltene Schwinden des Ligamentum teres beim Menschen
beweisen. Wie bekannt, liest man fast in jedem Handbuch der Anatomie bei der
Beschreibung des Ligamentum teres, dass dieses Band beim Menschen gelegentlich
fehlt, mitunter auch noch die Beifügung, dass dadurch die Function des Gelenkes
nicht beschränkt werde. Doch hat schon PALETTA (1) genauere Angaben darüber
gemacht. Nachdem er mitgetheilt, dass er einige Mal den Mangel des Ligamentum
teres beobachtet habe, fährt er fort: "Quod ligamentum, ubi desideratur,
rubescens quaedam macula in capitis summitate observatur, cui tenuis
supertenditur membrana locum designans, in quem vinculum teres immitti
debuisset. acetabuli autem fovea, ex qua ligamenti radices educuntur, vix
quidquam nisi informis pinguedo reperitur." Derselbe giebt auch noch
andere Literatur über das Fehlen des Ligamentum teres an (CALDANI, (2)
SANDIFORT, (3) SALZMANN, (4) BONN, (5) GENGA, (6) HUMPHRY (7)) giebt nur an: "It
may be wanting, without any special weakness of the joint being observed to
resultate from its absence". Dagegen beschreibt SAVORY (8) zwei
Hüftgelenke mit mangelndem Ligamentum teres aus dem Museum des St.
Bartholomeusspitals mit folgenden Worten: "In each joint the ligamentum
teres is completely wanting. The capsule of each is perfect and exhibited no
appearence of disease. In the usual situation of the attachement of the
ligamentum teres there is a deep depression in the head of the femur and just
above this the cartilage of each femur is slightly absorbed". Auch LANGER
(9) giebt zu: "Allerdings sind mir auch Fälle, aber nur von Greisen
bekannt, wo das Band gänzlich fehlte, die Fossa femoris und der Recessus
acetabuli nur durch Bindegewebe bedeckt waren". Ich hatte nun das Glück,
verflossenen Winter theils bei den Präparirübungen, theils in den
Operationskursen fünf Fälle von Fehlen des Ligamentum teres beim Menschen zu
beobachten und zwar sind die Fälle der Art, dass sie diese auffällige
Erscheinung völlig erklären. Das schönste meiner Präparate stammte von einem
auffallend kräftigen Manne in mittleren Jahren, der wegen Angina Ludovici in
die hiesige chirurgische Klinik kam und innerhalb weniger Tage starb. Im
rechten Hüftgelenk fehlte das Ligamentum teres vollständig. Die Kapsel war
völlig intact, namentlich bestanden keine Anzeichen, die auf eine früher
bestandene Zerreissung hinwiesen. Nach Eröffnung der Kapsel zeigte sich der
Gelenkkopf völlig normal und gänzlich überknorpelt; die Kapsel bot die
gewöhnlichen Insertionsverhältnisse dar. Die Fossa capitis lag an normaler
Stelle als ein ovales seichtes Grübchen von 8 mm längstem Durchmesser. Der
Grund desselben war völlig glatt, doch war der Knorpelüberzug an dieser Stelle
dünn, so dass die Unterlage bläulichroth durchschimmerte. Auch das Acetabulum
und sein Knorpelüberzug waren völlig intact. Durch die Incisura acetabuli schob
sich ein sehr gefässreicher Strang von Synovialgewebe ein, der die Fossa
acetabuli ausfüllte. Das Ligamentum teres mangelte gänzlich.
1)
Exercitationes pathologicae. Mediolani 1820 S. 68/69 und Deutsches Archiv für
die Physiologie von Meckel Bd. VI S. 341.
2)
Ex libris 26. Maji 1786.
3)
Observat. anat. pathol. lib. III cap. X.
4)
Haller. Diss. anat. vol. VIII.
6)
Anat. chirurg.
7)
On the human skeleton S. 521.
8) On the ligamentum teres. Journal of Anatomy and Physiology Vol. VIII.
9) Ueber das Gefässsystem der Röhrenknochen. Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien Bd. 35 S. 23.
Einen so exquisiten Fall fand ich nicht wieder. Die anderen Präparate zeigten alle Reste des Bandes in verschiedener Stärke, am Kopf meistens nur einige bindegewebige Fäden, einige Millimeter lang, oder auch gar nichts mehr, in der Fossa acetabuli dagegen Rudimente des acetabulären Theils des Bandes bis zu 2 cm Länge. Nur an einem Präparate, das von einer alten Frau stammte, zeigte auch der Knorpel in nächster Umgebung der Fossa capitis eine leichte Usuration, ein Vorkommniss, dem man keine Bedeutung beilegen kann, wenn man bedenkt, wie oft man solches in alten Gelenken mit vollständig intactem Ligamentum teres zu sehen bekommt. Aus den angegebenen Befunden geht aber klar hervor, dass das Fehlen des Ligamentum teres beim Menschen durch Resorption eines vorhandenen Bandes und nicht durch Mangel der Anlage zu erklären ist. Dafür spricht auch, dass meines Wissens nie Mangel des Ligamentum teres beim Kinde oder jugendlichen Menschen, sondern nur beim Erwachsenen oder Greise bemerkt worden ist. Vollends erwiesen wird diese Annahme dadurch, dass bei zweien meiner Fälle die Gelenke der anderen Seite die Resorption in ihrem ersten Beginn zeigten. Das Band war im Allgemeinen normal und kräftig, nur einige mm vor dem Ansatz an dem Kopfe war es bis auf die Hälfte seiner Breite wie durchnagt. Dadurch war offenbar die Stelle angegeben, wo später eine vollständige Trennung stattgefunden hätte. Die Trennung beginnt demnach in nächster Nähe des Kopfes entsprechend dem Theile des Bandes, der bei Bewegungen am meisten die Stelle verändert. Damit stimmt auch ganz überein, dass man gewöhnlich bei Lösung des Zusammenhangs noch ganz kurze Reste des Bandes am Kopfe anhängend, in der Pfanne dagegen grössere Stücke trifft. Wird schliesslich das Band vollends resorbirt, so haben wir ein Fehlen des Ligamentum teres beim Menschen". Dieser Mangel des Bandes scheint aber nach meinen Erfahrungen häufiger zu sein, als man gewöhnlich annimmt. (1)
1) Ich fand, wie gesagt, in 4-5 Wochen 5 Fälle, dann längere Zeit hindurch, wieder keinen. Um über die Häufigkeit dieses Mangels sichere Werthe zu erlangen, wird in Zukunft in den Zählkarten über Varietätenstatistik unseres Instituts (s. Anat. Anzeiger Nr. 23 1889 und Nr. 20 u. 21 1891) das Fehlen des Ligamentum teres notirt. Unter „Fehlen“ ist nach den obigen Ausführungen die mangelnde intracapsuläre Verbindung zwischen Kopf und Pfanne zu verstehen. Es werden also auch die Fälle, in denen Reste des Bandes am Kopfe oder in der Fossa acetabuli vorhanden sind, mitgezählt.
Was also beim Igel
und Orang Regel ist, kommt beim Menschen und, wie wir nach den früher
mitgetheilten Erfahrungen hinzufügen können, bei den übrigen Anthropoiden als
Ausnahme vor.
Fassen wir zum
Schlusse dieser Untersuchungen die Geschichte des Ligamentum teres mit kurzen
Worten zusammen, so lässt sich ungefähr Folgendes sagen. Das Ligamentum teres
ist ein ursprünglich bei den Reptilien ausserhalb des Gelenkes liegender
Abschnitt der Kapsel, ein Verstärkungsband derselben, welcher mit der
veränderten Stellung des Femur bei den Säugethieren für gewöhnlich in das
Gelenk einbezogen wird, unter gewissen Bedingungen jedoch auch als in das
Gelenk vorspringende Falte bestehen bleibt. Durch den Eintritt in das Gelenk
hat diese Kapselpartie ihre Function verloren und wird deshalb bei manchen
Thieren rudimentär oder schwindet ganz. Das Schwinden ist als eine Resorption
eines, wenigstens in der Anlage vorhandenen, Bandes aufzufassen. Ob es bei
einigen Thieren gar nicht mehr zur Anlage des Ligamentum teres kommt, kann ich
mit Bestimmtheit nicht sagen, es scheint dies aber nach meinen Untersuchungen
nicht wahrscheinlich. Unter gewissen Bedingungen wird das Band auch gar nicht
in das Gelenk aufgenommen, wenn nämlich die Stellung des Femur der ursprünglichen
gleicht (Echidna und Ornithorhynchus), oder wenn bei erfolgter Adduction des
Femur die Lage der Pfanne zum Gelenkkopf dieselbe geblieben ist (Nilpferd).
Diese Fälle unterscheiden sich von denen mit resorbirtem Bande dadurch, dass
sie die Incisura und Fossa acetabuli entbehren. Incisura und Fossa acetabuli
bilden sich nämlich erst infolge des Einrückens des Bandes in das Gelenk, da
nothwendig eine vertiefte Stelle bestehen muss, in welche sich das Band
einlagern kann, ohne die Mechanik des Gelenkes zu stören. Diese Modificationen
der Pfanne bleiben auch bei dem Schwinden des Bandes erhalten. Man wird demnach
aus dem Vorhandensein oder Mangel einer Incisura acetabuli bei fehlendem
Ligamentum teres schliessen können, ob das Band nicht mehr oder noch nicht
vorhanden ist. Diese Ansicht scheint mir ziemlich sicher; wenigstens lassen
sich alle Fälle, die ich näher untersuchen konnte, dadurch erklären. Ihre volle
Bestätigung wird sie allerdings erst dann finden, wenn bei den früher
angeführten Edentaten und anderen Thieren, die ich nicht untersuchen konnte,
Reste des Bandes entweder beim erwachsenen Thiere oder im Foetus nachgewiesen
sind.
II.
Entwicklungsgeschichte des Ligamentum teres.
Nachdem die
vergleichend anatomische Untersuchung ein allmähliches Einwandern des Ligamentum
teres in das Hüftgelenk gelehrt hatte, lag es nahe zu untersuchen, ob sich
diese Einwanderung auch entwicklungsgeschichtlich nachweisen lasse. Der Gedanke
schien um so berechtigter, als wir von anderen Gebilden, die im entwickelten
Zustande im Innern eines Gelenkes liegen, eine foetale Einwanderung kennen, z.
B. von der Bicepssehne des Schultergelenks. (1) In der That sprach auch WELCKER
(2) schon vor längerer Zeit diese Vermuthung aus. Die Beweise jedoch, die er
dafür anführen konnte, waren nicht vollständig überzeugend. "Bei der
Eröffnung der Schenkelpfanne eines Embryo der zehnten Woche, bei welchem die
Stelle der zukünftigen Fossa capitis fem. (entsprechend der stark auswärts
rotirten und gebeugten Schenkelhaltung der Embryonen) der Incisura acetabuli
sehr dicht anlag, schien es allerdings, als ob das Ligamentum teres nicht
ringsum frei, sondern wandständig sei." Später (3) fand er noch bei einem
siebenmonatlichen Foetus mit angeborener Hüftgelenksluxation ein Ligamentum
teres sessile. Auch die Beobachtung eines faltenförmigen runden Bandes beim
erwachsenen Menschen durch HYRTL (4) musste die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt
lenken, zumal die bisher vorliegenden entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten
(SCHUSTER, (5) VARIOT (6) u. A.) darauf keine Rücksicht nehmen.
Als Material
dienten mir Embryonen von Mäusen von 13,5 mm, von Schafen von 20 mm und vom
Menschen von nicht ganz 30 mm ab. Die ganze Hüftgelenksgegend wurde jedes Mal
in Schnittserien zerlegt.
Jüngere Stadien sind beim Menschen nur von HENKE und REYHER (7) (18-20 mm) und von SCHUSTER (1. c.) (22 mm) untersucht. Erstere erwähnen nur ganz kurz, dass beim Foetus von 18-20 mm die Pfanne mit einer Concavität den kugelrunden Kopf des Femur umgreift.
1) Welcker: Die
Einwanderung der Bicepssehne. Arch. f. Anat. u. Entw. 1878.
2) Ueber das
Hüftgelenk. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1878 S. 76.
3) Die Einwanderung
der Bicepssehne. Arch. f. Anat. u. Entw. 1878 S. 41.
4) TopographischeAnatomie Bd. II S. 607.
5) Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenks. Mittheilungen aus dem
embryol. Institut zu Wien Bd. I 1880.
6) Développement
des cavités et des moyens d'union des articulations. Thèse pour l'agrég. Paris
1883.
7) Studien über dieEntwicklung der Extremitäten. Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien Bd. LXX Abt. 3.
Gegen den
Schenkelkopf, der nur aus verhältnissmässig grossen, aber noch nicht zu
Knorpelzellen ausgebildeten Zellkörpern zusammengesetzt sei, werde die Pfanne
durch eine Zone kleinzelliger Bildungen abgegrenzt (S. 230). Von Ligamentum
teres erwähnen HENKE und REYHER nichts, dagegen heisst es bei ihnen "Schenkelhals
und Trochanter sind in entsprechender Grösse vorhanden". Letzteres
bestätigt SCHUSTER wörtlich für seinen 22 mm grossen Embryo. Auch sonst
schliesst er sich sehr an HENKE und REYHER an, doch geht er etwas näher auf das
Hüftgelenk ein. Uns interessiren hier besonders folgende Angaben: "Der
convexe Schenkelkopf zeigt eine bedeutende Abflachung an der Stelle des Umbo
und eine rinnenförmige Vertiefung im Verlaufe des Ligamentum teres" (S.
202). Das erste Entwicklungsstadium des Bandes findet er bei einem 15 mm langen
Kaninchenembryo, durch histologische Sonderung aus der Zwischenzone
hervorgegangen.
Da meine jüngsten
thierischen und menschlichen Embryonen ungefähr dieselbe Entwicklung darboten,
kann ich mich auf die Schilderung der letzteren beschränken. Bei dem kleinsten
Embryo von nicht ganz 30 mm Steiss-Scheitellänge und noch vollständig
knorpeligem Hüftbein und Femur (also wohl Ende des zweiten Monats) ist das
Hüftgelenk in allen seinen wesentlichen Bestandtheilen schon vorgebildet,
entbehrt jedoch noch vollständig der Gelenkspalte. Auch die Gewebe, die das
Gelenk zusammensetzen, sind schon differenzirt. Die Gelenkpfanne sowohl wie der
Femurkopf bestehen aus runden oder vielmehr polyedrischen Knorpelzellen mit
grossem, stark granulirtem Kern und wenig Zwischensubstanz. Gegen die
Epiphysengrenze des Femur zu ordnen sich die Knorpelzellen in querer Richtung.
In der Diaphyse werden sie grösser und zeigen zwischen sich viel hyaline
Zwischensubstanz. Da wo in der Gegend der späteren Gelenkspalte die beiden
Knorpel an einander stossen, liegen 4 bis 5 Zellenreihen bedeutend dichter, mit
abgeplattetem Kern. Dadurch entsteht bei schwacher Vergrösserung in gefärbten
Präparaten ein dunkler Streif, welcher der Gelenkspalte entspricht. Von der
medialen Seite aus schiebt sich zwischen Femur und Pfanne das Ligamentum teres
ein [s. Fig. 1]. Dieses ist an der Eigenart seiner Zellen leicht zu erkennen.
Ihre Kerne liegen nämlich dicht gedrängt, sind spindelförmig in die Länge
gezogen. und alle parallel gegen den Kopf hin angeordnet.
Es sind dies Ergebnisse, welche mit den von BERNAYS (1) am Kniegelenk gefundenen Thatsachen im wesentlichen übereinstimmen. Von einer Zwischenzone (HENKE und REYHER 1. c.) ist nicht mehr die Rede.
1) Die Entwicklungsgeschichte des Kniegelenks. Morph. Jahrb. Bd. IV. Morpholog. Arbeiten hrsg. v. G. Schwalbe II.
Wenigstens stossen
im weitaus grössten Theile des Gelenkes, lateral und oben, beide Knorpel direct
an einander, oder genauer, gehen in einander über. Die Grenze zwischen ihnen
ist nur durch die erwähnte Lage von dicht angeordneten, abgeplatteten
Knorpelzellen angegeben, wobei man vielfach nicht genau entscheiden kann, wie
viel dem einen und wie viel dem anderen Knorpel angehört. Die Knorpel sind von
einer stärker gefärbten perichondralen Schicht umgeben. Diese besteht aus in
mehreren Reihen angeordneten Zellzügen, die sich durch einen abgeplatteten
granulirten Kern und trübes Protoplasma auszeichnen und nach innen ganz
allmählich in die Knorpelzellen übergehen. Die Form des Gelenkes ist schon
typisch. Der Knorpel des Hüftgelenks bildet eine fast halbkugelige Pfanne. An
den Rand dieser Pfanne schliesst sich schon der Vorläufer des Limbus
cartilagineus an, indem hier die Zellen sich dichter anordnen, spindelförmige
Kerne zeigen und ein auf dem Querschnitte dreieckiges Gebilde constituiren,
welches zum Knorpel der Pfanne einen ganz continuirlichen Uebergang zeigt. Die
perichondrale Zone zieht über den Limbus cartilagineus hinweg. Auch das Caput
femoris zeigt schon seine Kugelgestalt, wie auch Andeutungen der Trochanteren
vorhanden sind. Der Femurkopf liegt jedoch in der Längsrichtung des Schaftes
und von einem Halse ist nichts zu erkennen. Die Kugelgestalt des Kopfes ist an
einer Stelle, innen unten, unterbrochen, indem ein Segment weggenommen ist. Es
ist dies da, wo sich das Ligamentum teres einschiebt. Das Band ist, wie
erwähnt, an seinen Zellen erkenntlich. Gegen die Pfanne zu sind die Kerne
weniger dicht gestellt, das Gewebe wird lockerer und man sieht einige
Gefässschlingen auftreten.
Die Hauptpunkte
dieses ersten Stadiums sind demnach, dass das Ligamentum teres in loco angelegt
wird und dass das Hüftgelenk überhaupt schon zu einer Zeit seine typische
Gestalt besitzt, wo von einer Gelenkspalte oder von einer geordneten
Muskelbewegung überhaupt noch keine Rede sein kann. Der Unterschied gegenüber
den Befunden von BERNAYS am Knie im gleichen Stadium liegt nur darin, dass die
Entwicklung am Hüftgelenk schon etwas weiter gediehen ist, was damit zu
erklären ist, dass die proximalen Gelenke sich früher ausbilden als die
distalen.
Das nächste Stadium der Entwicklung (Fig. 2) konnte ich an einem 34 mm langen Foetus beobachten. Der wesentlichste Unterschied gegenüber dem Stadium I besteht darin, dass jetzt eine Gelenkspalte aufgetreten ist. Der Foetus zeigt geringe Verknöcherung in der Diaphyse des Femur und die allerersten Anfänge derselben im Darmbein (also wohl Anfang des dritten Monats). Die Pfanne bietet dieselben Verhältnisse dar wie im vorigen Stadium, nur ist der Limbus cartilagineus jetzt deutlich differenzirt und kräftig ausgebildet, so dass er den Femurkopf rings umfasst. Das obere Ende des Femur ist jetzt deutlicher modellirt als in der vorigen Periode, indem die beiden Trochanteren scharf hervorspringen, namentlich aber dadurch, dass jetzt die erste Andeutung eines Halses auftritt. Der Hals ist allerdings nur in sehr stumpfem Winkel zum Schaft abgebogen, zeigt sich jedoch als Verbindungsglied zwischen Kopf und Schaft dadurch, dass die Wölbung des Kopfes den Durchmesser des Halses allseitig überragt. Bemerkenswerth ist das starke Hervortreten des Trochanter minor um diese Zeit, worauf auch schon VARIOT (1) aufmerksam macht. Die wichtigste Erscheinung in diesem Stadium ist jedoch, wie gesagt, das Auftreten der Gelenkspalte. Die Höhle ist sowohl zwischen den direct an einander liegenden Knorpeln des Darmbeins und des Schenkelbeins als auch zwischen Schenkelkopf und rundem Bande kenntlich. Sie tritt auf den einzelnen Schnitten in Gestalt feiner Spalten auf. Sie ist noch sehr gering und scheint sogar auf der einen Seite noch nicht das ganze Gelenk zu durchsetzen, da auf verschiedenen Schnitten die Knorpelzellen continuirlich neben einander liegen, ohne dass auch bei starker Vergrösserung ein Spalt zu erkennen wäre. Die Spalten scheinen zuerst in den lateralen Partien des Gelenkes und zwischen Ligamentum teres und Kopf aufzutreten und später zusammenzufliessen. In Bezug auf die Erklärung der Spaltbildung stimme ich vollständig mit BERNAYS (2) überein. Die Spalten entstehen durch Dehiscenz in Folge der ersten Muskelcontractionen. Denn die Muskelfibrillen lassen jetzt überall abwechselnd einfach und doppelt lichtbrechende Substanz unterscheiden. Die Knorpel liegen sich bei der Spaltbildung nackt gegenüber, von einem chondrogenen oder gar einem Zwischengewebe ist hier keine Spur mehr vorhanden. Nur die zwei bis drei obersten Zellenlagen sind dichter angeordnet und zeigen in der Krümmungsfläche des Gelenks abgeplattete Kerne. Nur darin weiche ich von Bernays ab, dass sich bei der Spaltbildung die Knorpelflächen auch gleich glatt gegenüberliegen sollen. Ich fand mehrfach gerade da, wo der Spalt zwischen zwei Knorpeln am dünnsten ist oder sich auch vollständig verliert, nicht blos einzelne Zellen, sondern auch ganze Zellstränge von 5 und mehr Zellen sich von einem Knorpel abheben und gegen die beginnende Höhle vorspringen. Meist war es eine einfache, selten eine doppelte Zelllage, die so in das Gelenk vorragte. Die Zellen. sind ganz dieselben wie die, welche die Oberfläche der Knorpel bilden, nur war ihr Kern z. T. weniger intensiv gefärbt; sonstige Degenerationserscheinungen waren nicht wahrnehmbar. Mir erscheint diese Wahrnehmung ebenfalls für eine Dehiscenz der Gelenkflächen zu sprechen. Es beweist dies eben, dass die Lösung nicht zwischen zwei bestimmten Zelllagen stattfindet, sondern dass gelentlich auch eine oder zwei Zellreihen zerrissen werden. Diese losgerissenen Zellen gehen wahrscheinlich später durch fortgesetzte Bewegungen im Gelenk zu Grunde, wenigstens sind sie weiter peripher, wo die Gelenkspalte grösser ist, wie auch in späteren Stadien nicht mehr zu finden. Dass sie eine Verflüssigungsmetamorphose durchmachen, dafür fehlt jeder Anhaltspunkt.
1) Développement
des cavités etc.
2) Morph. Jahrb. Bd. IV.
Das Ligamentum teres ist dadurch, dass es rings von der Gelenkhöhle umgeben ist, deutlich als Band zu erkennen. Es imponirt durch seine ausserordentliche Stärke. Wie man auf dem Schnitt Fig. 2 sieht, ist es an seiner Insertion gut halb so breit wie der Durchmesser des Kopfes. Sein Gewebe hat sich gegenüber dem ersten Stadium stärker differenzirt, was sich besonders dadurch ausspricht, dass die Spindelgestalt sowohl am Kern als auch an der ganzen Zelle viel deutlicher geworden ist. Bei schwacher Vergrösserung unterscheidet man einen dunkelgefärbten dichteren Theil, welcher zunächst dem Kopfe liegt und in das primitive Kapselband übergeht, und einen helleren, gefässreichen Theil im Grunde der Pfanne. Der dunkelgefärbte Theil setzt sich bei stärkerer Vergrösserung aus äusserst dicht gedrängten spindelförmigen Zellen zusammen, deren Längsaxe der Richtung des Bandes parallel zieht. Gegen die Oberfläche zu verlieren die Kerne ihre Spindelgestalt, sehen mehr plattgedrückt aus und gleichen ganz den ihnen gegenüberliegenden embryonalen Knorpelzellen des Kopfes. An der Insertionsstelle des Bandes vollends findet ein ganz allmählicher Uebergang der Bindegewebs- in Knorpelzellen statt. Der helle Theil des Bandes besitzt nur spärliche spindelförmige Bindegewebszellen, dazwischen eine durchsichtige, homogene Zwischensubstanz in reichlicher Menge mit eingelagerten fibrillären Elementen. In diesem Gewebe liegen Gefässschlingen. Das ganze Gewebe erinnert sehr an das Unterhautbindegewebe zu dieser Zeit. Gegen den Pfannengrund ist es ziemlich scharf abgesetzt. Gefässschlingen dringen unter dem Schutze des Bandes an manchen Stellen bis an den Kopf heran, doch nirgends in denselben hinein. (SCHUSTER (1) fand bei einem 16 bis 18 Tage alten Kaninchenembryo Gefässe in den knorpeligen Gelenkkopf an der Insertionsstelle des Bandes eintreten.
1) Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenks. Mittheilungen aus dem embryol. Institut zu Wien Bd. I S. 205.
Dadurch dass
gleichzeitig mit der übrigen Gelenkhöhle sich auch die Spalte zwischen Kopf und
Band bildet, durchzieht das Band frei die Gelenkhöhle sofort bei ihrem
Auftreten. Zur Bildung eines wandständigen Ligamentum teres, wie es Welcker (1.
c.) vermuthete, kommt. es also beim Menschen nicht mehr, und es ist demnach das
von HYRTL beobachtete Ligamentum teres sessile nicht als Persistenz einer
foetalen Anlage, sondern als eine abnorme Bildung aufzufassen.
Ich habe schon
erwähnt, dass das Ligamentum teres in diesem Stadium auffallend stark ist. Es
scheint dadurch der Gelenkkopf förmlich nach hinten und oben aus der Pfanne
getrieben. An der betreffenden Stelle ist der Limbus cartilagineus abgeflacht,
ja auf einigen Schnitten verursacht der Rand der Pfanne eine leichte Deformation
des Kopfes.
Die nächste Stufe der Entwicklung konnte ich bei einem Embryo von 47 mm Steiss-Scheitellänge studiren (Fig. 3 u. 4). Die Veränderungen, die jetzt noch eintreten, sind ziemlich secundärer Natur. Die Configuration des Gelenkes gleicht schon ausserordentlich dem Zustande, wie wir ihn demnächst beim Neugeborenen zu beschreiben haben. Der Kopf ist wieder mehr in die Pfanne aufgenommen, womit eine theilweise Reduction des runden Bandes, namentlich in seinem lockeren Abschnitt verbunden ist. Dennoch ist das Ligamentum teres noch. auffallend mächtig und erzeugt, wie aus den Abbildungen klar hervorgeht, eine starke Defiguration des Kopfes, an seinem Ansatz eine Grube und seinem Verlauf entsprechend eine Rinne. Die Gelenkhöhle erstreckt sich über die Stellen directer Berührung zwischen Kopf und Pfanne (bezw. Limbus cartilagineus) hinaus, abwärts am Kopfe ein Stück weit zwischen Perichondrium und Kapsel. Der Hals ist viel deutlicher als in der vorigen Entwicklungsperiode und gleicht ganz dem des Neugeborenen. Der Trochanter major ist jetzt entsprechend ausgebildet und überwölbt eine tiefe Fossa trochanterica. Die Verknöcherung im Schaft ist bis zum Abgang des Halses vorgeschritten. Die Epiphyse ist noch ganz knorpelig, doch dringen schon vielfach von der Umgebung des Halses aus, bes. an der lateralen und medialen Seite, Gefässcanäle in denselben ein. Vom Ligamentum teres dagegen geht kein Gefäss in den Kopf über. Die Vascularisation der Epiphysen beobachtete BERNAYS (1) am Kniegelenk erst bei Embryonen von 10 bis 12 cm Steiss-Scheitellänge. Auch diese Erscheinung deutet darauf hin, dass die Entwicklungsvorgänge im Hüftgelenk in etwas früherer Zeit vor sich gehen als im Kniegelenk; doch ist sie insofern etwas auffallend, als bekanntlich in der unteren Epiphyse des Hüftgelenks früher ein Knochenkern auftritt als in der oberen. Die Knorpelflächen, welche in der Gelenkhöhle einander gegenüber liegen, sind ganz glatt, nur hie und da findet man eine vereinzelte Zelle zwischen ihnen. Der Limbus cartilagineus ist verhältnissmässig kleiner, aber dichter als im letzten Stadium.
1) Morph. Jahrb. Bd. IV.
Die folgenden Zeiten
der Entwicklung bis zur Geburt bieten wenig Interessantes mehr. Die
Verknöcherung der Diaphyse schreitet weiter bis in den Hals hinein fort, ebenso
die Vascularisation des Kopfes, ohne dass jedoch bis zur Geburt ein Knochenkern
darin aufträte. Vom fünften bis sechsten Monat ab dringen auch vom Ansatzpunkte
des Ligamentum teres aus einige Gefässe in den Kopf, ohne jedoch mit den vom
Umkreis des Halses aus eingewucherten zu anastomosiren. Die Knorpelflächen
sind, soweit sie sich direct gegenüberliegen, vollständig glatt und nackt. Doch
erstreckt sich die Gelenkhöhle noch weiter abwärts am Halse gegen die
Trochanteren hin zwischen Perichondrium und Kapsel, wo sie schliesslich mit
einer Ausbuchtung endet. Das runde Band wird verhältnissmässig etwas schwächer
wie früher, ist aber immer noch recht kräftig und defigurirt den Kopf deutlich.
Beim Neugeborenen finden wir schliesslich folgende Verhältnisse. Der Oberschenkel ist ziemlich gebeugt und kann spontan nicht gerade gestreckt werden; auch mit Gewalt ist dies nicht möglich, ohne dass eine compensirende Lordose der Lendenwirbelsäule eintritt. Die Ursache davon ist bekanntlich die relative Kürze des Ligamentum ilio-femorale. Der Oberschenkel wird in Beugestellung angelegt, und daher die relative Kürze aller auf der Beugeseite gelegenen Theile. Hat man das Gelenk eröffnet und das Femur in die beim Neugeborenen normale Lage gebracht, so hat das Ligamentum teres eine prismatische Gestalt. Man unterscheidet eine vordere, eine hintere und zugleich obere und eine untere Kante. Die erste und letzte werden von den sehnenartigen Strängen gebildet, welche von den beiden Lippen der Incisura acetabuli entspringen, die hintere Kante entspricht der aus der Fossa acetabuli aufsteigenden Synovialduplicatur, welche die beiden Stränge umhüllt. Die drei Kanten ziehen parallel und gerade, nur ganz wenig convergirend zur Fossa capitis. Strecken wir jetzt den Oberschenkel, so erleiden die Kanten des Bandes eine leichte Torsion. Also auch das Ligamentum teres ist entsprechend der Beugelage des Oberschenkels angelegt. Die Fossa capitis ist tief und von ihr zieht sich in der Richtung des Bandes (bei Foetalstellung des Gelenkes) eine Rinne gegen den Rand des Gelenkkopfes hin, so dass bei einem Schnitt durch das Gelenk parallel der Mitte des Ligamentum teres, die Kugelgestalt des Kopfes vom Ansatze des Bandes ab nach innen merklich alterirt ist. Durch die Fossa capitis ist von dem medialen Pol des Kopfes ein Kugelsegment abgeschnitten, so dass der Kopf beim Neugeborenen einer quer comprimirten Kugel oder einem quergestellten Cylinder gleicht. Auch AEBY (1) hat dies schon erkannt, hält aber die Abweichung von der Kugelgestalt für zufällig.
1) Die Umformung des Schulter- und Hüftgelenks. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. VI S. 383.
Der Hals ist noch
lange nicht so scharf gegen den Kopf abgesetzt wie beim Erwachsenen und bildet
mit dem Schaft einen weit stumpferen Winkel wie bei letzterem. Die
Diaphysenverknöcherung reicht in die untere Hälfte des Halses hinein bis an den
medialen unteren Umfang des Kopfes. Der Kopf selbst ist vielfach von
Gefässcanälen durchzogen. Die Gefässe treten hauptsächlich in zwei
Periostfalten, die von einer Synovialduplicatur umhüllt sind, an den Kopf
heran. Die eine kommt von innen unten, vom Trochanter minor her, die andere von
aussen oben, vom Trochanter major. Nur wenige Gefässchen, 3 bis 4, treten vom
Ligamentum teres aus in den Kopf. Dieser zeigt ebensowenig wie der Trochanter
major bei der Geburt einen Knochenkern.
Wenn das runde Band auch nicht mehr so mächtig ist wie beim Foetus, so ist es doch noch im Vergleich zum Erwachsenen stark. Der Querschnitt des Bandes verhält sich nach meinen Messungen zu dem des Kopfes wie 333: 1000. Schon der jüngere SANDIFORT (1) erkannte, dass das Ligamentum teres in früherer Zeit des Embryonallebens dicker sei als später, und HUMPHRY (2) hat die Vermuthung ausgesprochen, dass das Band von der Foetalzeit ab bis zum erwachsenen Zustande relativ schwächer werde. WELCKER (3) hat daraufhin Messungen gemacht und kam zu dem Resultate, dass das Band bis zur Geburt zunehme, von da ab aber schwächer werde. Meine Messungen bestätigen die Annahme HUMPHRY'S, indem sie zeigen, dass von der Anlage bis zum vollendeten Wachsthum das Ligamentum teres im Verhältniss zu den übrigen Componenten des Hüftgelenks gleichmässig schwächer wird. Diese Abnahme geht constant vor sich, bis im Alter von 17 bis 18 Jahren das definitive Verhältniss ziemlich erreicht ist.
1) Animadversiones de vitiis congenitis et de fracturis articulationis coxae. Leyden 1834; citirt nach von Ammon: Die angeborenen chirurgischen Krankheiten des Menschen 1842.
2) On the human skeleton including the joints.
3) Zur Anatomie des Ligamentum teres femoris. Zeitschr. f. Anat. u. Entw.
In Folge der
Torsion, welche das Band von der Geburt ab bei den Bewegungen des Femur
erleidet, verliert es mit zunehmendem Alter seine ursprüngliche prismatische
Gestalt immer mehr, indem an der Insertionsstelle am Kopfe die drei Kanten
confluiren. Nur bei ganz besonders kräftigen Bändern kann man beim Erwachsenen
die ursprüngliche Gestalt noch deutlich erkennen. Durch die Torsion wird aber
der von weichem Bindegewebe und Gefässen erfüllte Binnenraum des Bandes
beeinflusst, indem er gegen die Fossa capitis zu allmählich. vollständig
obliterirt.
Häufig stehen
jedoch die Rückbildungsvorgänge am Ligamentum teres auch im erwachsenen
Zustande nicht still, sondern schreiten fort, bis es schliesslich in gar nicht
seltenen Fällen zum vollständigen. Schwunde des Bandes kommt, wie wir schon
gesehen haben.
Fassen wir zum
Schlusse dieser Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte des Ligamentum
teres die Ergebnisse kurz zusammen, so erhalten wir folgende Resultate. Das
Ligamentum teres wird beim Menschen (und bei Maus und Schaf) in loco aus dem
embryonalen Bildungsgewebe angelegt, aus dem auch die Knorpel und der Limbus
cartilagineus sich aufbauen. Es entsteht durch histologische Differenzirung des
ursprünglich indifferenten Gewebes zu Binde- bezw. Sehnen gewebe. Ein Stadium, wo das Band ausserhalb des Gelenkes liegt, wie wir es
vergleichend anatomisch kennen gelernt haben, kommt beim Menschen höchstens in
der allerersten Anlage vor, wo es eine Zeitlang scheinen könnte, als werde sich
die Gelenkhöhle nur lateralwärts vom Ligamentum teres entwickeln. Das Stadium
eines wandständigen Ligamentum teres bildet sich beim Menschen überhaupt nicht,
sondern der Gelenkspalt tritt gleichzeitig rings um das Band herum auf, so dass
es sofort frei das Gelenk durchzieht. Damit steht vollständig im Einklang der
Umstand, dass es mir nicht gelungen ist, beim Menschen ein Wandern der Fossa
capitis nachzuweisen in der Art, dass sie zuerst wandständig, dann mehr central
liegt. Bei seinem ersten freien Auftreten in der Gelenkhöhle ist das Ligamentum
teres sehr mächtig, sein Querschnitt ist gut dem halben Durchmesser des Kopfes
gleich. Von da ab tritt eine stetige relative Reduction des Bandes ein, so dass
es bei der Geburt noch etwas über ein Drittel des Kopfdurchmessers breit ist.
Nach der Geburt schreitet die Reduction immer weiter. Begünstigt wird sie jetzt
vor allem durch die mit der Streckbewegung eintretende Torsion des Bandes.
Dadurch geht die beim Neugeborenen noch prismatische Gestalt in die spätere
pyramidenförmige über. Es verödet das weiche gefässhaltige Bindegewebe im
Innern des Bandes, zunächst am Kopfe, und später tritt auch hier zuerst
Schrumpfung der sehnigen Elemente auf, die bis zu vollständigem Schwund führen
kann. Daraus folgt aber, dass das Fehlen des Ligamentum teres beim Menschen
nicht als angeborene Bildungsanomalie aufzufassen ist, wie dies von
verschiedenen Seiten geschehen ist (SANDIFORT, PALETTA, AMMON). Auch ist mir
kein Fall bekannt von Mangel des Bandes bei einem Kinde oder gar einem
Neugeborenen.
Gerade umgekehrt
sind die Veränderungen, welche das Gelenkende des Femur von der Geburt bis zur
vollendeten Entwicklung eingeht. Der Hals modellirt sich immer schärfer, indem
er immer mehr von der Wölbung des Kopfes überragt wird; der Winkel, in dem er
sich an den Schaft ansetzt, wird immer weniger stumpf. Die Defiguration, welche
am Kopfe durch die Fossa und die davon ausgehende Rinne erzeugt wird, nimmt
immer mehr ab, da die Grube relativ seichter wird und die Rinne schliesslich
ganz verschwinden kann. Der Kopf wird so zur Halbkugel, ja entfernt sich
schliesslich nach der entgegengesetzten Seite wie beim Neugeborenen von der
Kugelform. Der Rest der Rinne des Ligamentum teres nimmt bei gewöhnlicher
Haltung des Beines, beim Stehen, das Band nicht mehr auf, sondern weicht nach hinten
in spitzem Winkel ab. Die Erklärung dafür giebt uns die Entwicklungsgeschichte,
welche zeigt, dass das Ligamentum teres entsprechend der Beugelage des Femur im
Foetus angelegt wird. Bei dieser Haltung der Extremität entsprechen sich Band
und Rinne. Bei der Streckung des Schenkels nach der Geburt bleibt die Rinne
noch längere Zeit bestehen, manchmal bis zum erwachsenen Zustand. Eine neue
Rinne in der nunmehr gewöhnlichen Haltung des Bandes bildet sich nicht, weil
das Band schon so weit reducirt ist, dass es keinen Druck mehr auf den Kopf
ausübt, sondern völlig in der Fossa acetabuli Platz hat. Alle diese Erfahrungen
zusammengehalten sprechen wohl auch für die Functionslosigkeit des runden
Bandes, wenigstens beim erwachsenen Menschen, ein Resultat, zu dem uns ja auch
die vergleichend anatomische Untersuchung schon geführt hat. Näher zu begründen
werden wir diese Ansicht später haben.
III.
Gefässverhältnisse des Ligamentum teres.
Bekanntlich stellte
SAPPEY (1) im Jahre 1844 die Theorie auf, die Function des Ligamentum teres
sei, die zum Schenkelkopf tretenden Gefässe zu beschützen. Und zwar formulirte
er diese Ansicht folgendermassen: "Le ligament rond, dont on a longtemps
cherché les fonctions, nous paraît avoir pour usage principal de protéger les
vaisseaux qui se portent à la tête du fémur; il doit être considéré comme un
canal fibreux inséré par l'une de ses extrémités autour de l'orifice par lequel
ces vaisseaux pénètrent dans l'articulation et par l'autre autour de la
dépression creusée au sommet de la tête du fémur dans laquelle ils plongent;
c'est une sorte de gaîne qui assure l'intégrité de ces vaisseaux en supportant
seule tous les efforts de traction produits par le déplacement de la tête
fémorale. La couche adipeuse qui occupe l'excavation de la cavité cotyloïde est
pour cette gaîne une sorte de coussinet qui a pour but de prévenir la
compression des vaisseaux contenus dans son épaisseur. Tant de précautions
prises par la nature ne semblent-elles pas indiquer l'importance de ce petit
appareil vasculaire que les injections, même grossières, pénètrent facilement?"
Seitdem sind die
Ansichten der Anatomen und Chirurgen über das Ligamentum teres als Leitband für
die Gefässe getheilt, und es scheint, als sei auch heute noch keine Einigkeit
erzielt.
Kurz nach SAPPEY erklärte HYRTL: (2) "Dass das runde Band dem Schenkelkopf Ernährungsgefässe zuführt, ist unrichtig. Ich habe mich. durch die subtilsten Injectionen überzeugt, dass die Arterien des Lig. teres, selbst bei Embryonen, nicht in die spongiöse Substanz des Schenkelkopfs eindringen, sondern an der Einpflanzungsstelle des Bandes schon capillar werden und durch Umbiegungsschlingen in die Venen umlenken." In seiner topographischen Anatomie (3) wiederholt er dasselbe, nur giebt er die Möglichkeit zu, dass bei jungen Embryonen Gefässe in den Kopf übergehen.
1) Traité d'anatomie T. I S. 653.
2) Beiträge zur
angewandten Anatomie des Hüftgelenks. Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der
Aerzte zu Wien 1846 Bd. I S. 58.
3) Topogr. Anatomie Bd. II S. 607.
LUSCHKA (1) dagegen
sagt: "Im Gegensatz zu HYRTL muss ich die bestimmte Erklärung abgeben,
dass ich im Innern des Bandes niemals Zweigchen der Art. obturatoria vermisst
habe, welche ihren Weg durch Poren der Fossa capitis in die Substanz des
Schenkelkopfs nehmen, während allerdings die seiner Synovialhülle angehörigen
Gefässe im Umkreise jener Grube schlingenförmige Endbiegungen erfahren."
Der einen oder anderen Ansicht schlossen sich die meisten Autoren an. Den Uebertritt von Gefässen in den Schenkelkopf leugnen mit Hyrtl NUHN (2) u. A., während GEGENBAUR, (3) KRAUSE, (4) BEAUNIS und BOUCHARD, (5) MOREL und DUVAL (6) u. s. w. sich Sappey anschliessen. Eine vermittelnde Stellung nehmen HENLE (7) und WELCKER (8) ein. Ersterer lässt es unentschieden, "ob die Gefässe, welche das Ligamentum teres führt, mit den Gefässen des Schenkelkopfs communiciren. oder nicht". Letzterer suchte aus dem Vorhandensein oder Fehlen von kleinen Oeffnungen am macerirten Knochen, welche die Fossa capitis durchbrechen, zu bestimmen, ob und wie oft Gefässe aus dem runden Band in den Schenkelkopf übertreten. In der Fälle fand er gar keine Poren, aber auch in den übrigen / muss die Blutmenge, welche dadurch in den Schenkelkopf einzudringen vermag, ausserordentlich gering sein, so dass auch in diesen Fällen die Bedeutung des Bandes als „Gubernaculum vasorum" kaum in Anschlag kommen dürfte." Bei Kindern und jugendlichen Individuen schienen ihm die Foramina ganz zu fehlen. Auch ich untersuchte die Fossa capitis auf das Vorhandensein von Poren und fand sie unter 28 Fällen 13 Mal fehlen. Wie ich das Ergebniss dieser Untersuchungen beurtheile, davon später.
Ausser diesen mehr beiläufigen Angaben besitzen wir aber in der Literatur zwei Arbeiten, welche sich genauer mit den Gefässverhältnissen des Ligamentum teres und des Schenkelkopfes überhaupt befassen, von WALBAUM 9) und von LANGER. 10)
1) Die Anatomie des Menschen Bd. II 1. Abth. S. 314.
2) Lehrbuch der
praktischen Anatomie S. 179.
3) Lehrbuch der
Anatomie des Menschen S. 299.
4) Handbuch der
menschlichen Anatomie Bd. I S. 76 u. Bd. II S. 132.
5) Nouveaux
éléments d'anatomie descriptive. Paris 1880 S. 175.
6) Manuel de l'anatomiste 1883
S. 264.
7) Handbuch der
system. Anatomie Bd. I S. 128.
8) Ueber das Hüftgelenk
u. s. w.
9) De arteriis articulationiscoxae. Diss. Lipsiae 1855.
10) Ueber das Gefässsystem der Röhrenknochen. Denkschriften der Wiener Akademie Bd. XXXVI.
Bevor wir jedoch
auf diese Arbeiten näher eingehen, ist noch eines Autors zu gedenken, der schon
20 Jahre vor Sappey eine ganz ähnliche Theorie aufstellte. Ich meine PALETTA. (1)
Nachdem er zu dem Resultate gekommen war, dass der Zweck des Bandes nicht der
sein kann, die Gelenkflächen in Contact zu halten, beschrieb er eine kleine
Arterie, Ast der A. obturatoria, welche durch die Incisura acetubuli eindringt
und dann in zwei Zweigchen zerfällt, eines für die Fossa acetabuli und eines
für das Ligamentum teres. Auch erwähnt er, dass man diese Gefässe schon beim 7
bis 8 monatlichen Foetus präpariren könne. Sodann sagt er (S. 71): "Exposita
sic ligamenti interioris structura, una cum observationibus pathologicis ad id
attinentibus, statuendum esse apparet, munus ligamenti aliud non esse, quam
illud, vasa nempe sanguinea intra funiculi caveam dirigere. eaque protegere, ut
nutrioniinserviant, tunc etiam abnormes. capitis motus aliquo modo
coërcere."
Die Gefässversorgung des Schenkelkopfes ist immer noch nicht genügend bekannt, obwohl wir eine gute Beschreibung von WALBAUM (1. c.) besitzen und auch WELCKER (2) wieder darauf aufmerksam gemacht hat. Sehen wir zunächst von der zweifelhaften Blutversorgung durch das Ligamentum teres ab, so empfängt der Schenkelkopf seine Gefässe hauptsächlich von zwei Seiten, und zwar von oben aussen, von der Gegend des Trochanter major her, und von innen unten, vom Trochanter minor her.
1) Exercitationes pathologicae. Mediolani 1820.
2) Ueber das Hüftgelenk u. s. w. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1876.
Die auf dem ersten Wege eintretenden Gefässe sind die stärkeren. Es dringt nämlich in der angegebenen Gegend ein Arterienstämmchen, das nach Welcker von der A. circumflexa med. kommt, durch die Pfanne hindurch und zieht, in eine longitudinale, der Richtung des Schenkelhalses parallele Periostfalte eingeschlossen, gegen den Rand des überknorpelten Schenkelkopfes vor, und tritt in mehrere Zweigchen getheilt in denselben ein. Nach Welcker findet man an dieser Stelle 6 bis 12 Foramina nutritia von ca. 1 [] mm Querschnitt. Die von unten innen herkommenden Gefässe sind etwas schwächer. Sie stammen gewöhnlich von der A. obturatoria. Das Stämmchen dringt etwa in der Mitte zwischen Trochanter minor und Schenkelkopf durch die Kapsel hindurch und steigt dann in eine starke Periostfalte gehüllt gegen den Kopf auf, den es mit mehreren Zweigchen durchsetzt. Walbaum konnte diese Gefässe bis über die Mitte des Schenkelkopfes hinaus makroskopisch präpariren. Ich möchte hier noch besonders auf die Periostfalten aufmerksam machen, welche die Gefässe zum Kopfe leiten. Sie sind immer deutlich, namentlich ist die innere oft sehr kräftig entwickelt und von dem darunterliegenden Knochen abgehoben, mit dem sie dann nur noch durch eine Synovialduplicatur zusammenhängt, ein Verhältniss, das in gewissem Sinne an das Ligamentum teres erinnert. Beide Periostfalten sind in demselben Meridian des Kopfes angeordnet; es ist dies derjenige Meridian, in welchem beim aufrechten Stehen auch das Ligamentum teres verläuft.
Die bis jetzt
beschriebenen Gefässe kann man an allen nur einigermassen gut injicirten
Leichen erkennen und bequem bis zu ihrem Eintritt in den Kopf präpariren.
Ueber die durch die
Incisura acetabuli in das Gelenk eintretenden Gefässe steht jedenfalls so viel
fest. Das Arterienstämmchen kommt von der A. obturatoria oder circumflexa med.,
vielleicht am häufigsten von einer Anastomose dieser beiden Arterien, die
gerade an der Incisura liegt. Es tritt in der Tiefe der Incisura unter dem
Ligamentum transversum ein und theilt sich nach kurzem Verlaufe in eine A.
acetabuli und in eine A. ligamenti. Erstere, die etwas stärker ist, zieht zu
dem fetthaltigen Bindegewebe der Fossa acetabuli und endet. schliesslich mit
einigen Zweigchen im Knochen des Pfannenbodens. Die A. ligamenti steigt
zwischen den sehnigen Bestandtheilen des Bandes und der Synovialduplicatur zur
Fossa capitis auf und giebt dabei mehrere Zweigchen ab, welche sich in der
Synovialduplicatur verästeln. Directen Uebertritt durch die Fossa capitis in
die Substanz des Kopfes konnte Walbaum nur einige Mal durch Injection.
nachweisen. Mehrfach versagten die Injectionen. Ich konnte auf dem Querschnitt
des Bandes an seiner Ansatzstelle auch an gut injicirten Leichen niemals mehr
den Querschnitt von Arterien erkennen.
LANGER (1) untersuchte gelegentlich seiner Arbeit "Ueber das Gefässsystem der Röhrenknochen" auch diesen Punkt genauer und kam zu folgendem Ergebniss.
1) 1. c. S. 22-24.
Bei Kindern ist
constant ein Zweig der A. obturatoria nachweisbar, welcher durch das Ligamentum
teres hindurch in den "noch knorpeligen" Gelenkkopf eintritt und in
den Knorpelcanälen des Kopfes Aeste abgiebt, welche den Zweigen jener Arterien
entgegenziehen, die am Rande der Gelenkfläche eindringen. Eine Anastomose
dieser verschiedenen Zweige tritt erst mit der Bildung des
Verknöcherungspunktes ein. Dann fährt er fort: Auch bei älteren Kindern und
selbst bei Erwachsenen ist es mir einige Male gelungen, durch das Ligament
durchlaufende Arterien zu injiciren." Auch den Austritt von Venen konnte
er durch Injection in die Spongiosa des Kopfes nachweisen, aber erst dann, wenn
die anderen Abzugswege des venösen Blutes künstlich verschlossen waren. LANGER
hält den Uebergang von Gefässen in und aus dem Schenkelkopf für typisch und für
den Bildungsvorgang des Knochens für höchst wichtig. "In der überwiegend
grösseren Mehrzahl der Fälle bleiben die Blutbahnen im Bande gewiss (auch später)
offen, bald enger, bald weiter; darnach richtet sich dann die Menge und Weite
der Gefässöffnungen im Umbo."
Ich untersuchte eine Reihe von Foeten
verschiedenen Alters und Kinder bis zum vierten Lebensjahre an Serienschnitten
durch das Gelenk, bezw. das Ligamentum teres und seinen Ansatzpunkt, auf die
Gefässverhältnisse und kann darnach Folgendes sagen. Beim ersten Auftreten des
Bandes (Stadium I des vorigen Kapitels) ist von Gefässen im Ligamentum teres
keine Rede, dagegen sind in der Fossa acetabuli einige Gefässschlingen zu
erkennen. Im Stadium II (34 mm Steiss-Scheitellänge) werden an mehreren Stellen
des lockeren Bindegewebes gegen die Fossa acetabuli zu Gefässchen getroffen (s.
Fig. 2), die an einer Stelle auch bis an die Knorpelzellen des Kopfes
hervorragen, ohne jedoch in denselben einzudringen. SCHUSTER (1) sah, wie schon
früher erwähnt, bei 16-18 Tage alten Kaninchenembryonen Gefässe in den Kopf
eindringen. Im III. Stadium (47 mm) sind die Gefässe in der Fossa acetabuli und
am Gelenkkopf noch deutlicher, aber in den Kopf selbst dringen vom Ligamentum
teres aus keine Gefässe ein. Dagegen sieht man jetzt schon von der medialen und
lateralen Seite des Halses aus, an denselben Stellen wie beim Erwachsenen,
Canäle im Knorpel und darin Gefässe (Fig. 3 u. 4). Die Mehrzahl dieser Gefässe
zieht abwärts zum Femurschaft in den Verknöcherungskern der Diaphyse, einige
steigen jedoch auch zum Kopfe auf. In den folgenden Monaten des Foetallebens
schreitet die Vascularisation des Kopfes weiter, aber erst bei Foeten von 12 cm
Länge sah ich Gefässe in den Kopf eintreten und zwar in zwei Canälchen, später
im 7. Monate zählte ich 3 bis 4 Zweigchen. Es sind immer bedeutend weniger, als
von den Seiten her eindringen. Beim Neugeborenen ist. im Kopfe noch kein
Knochenkern vorhanden, dagegen ist der Knorpel stark vascularisirt, wie sich an
Schnitten durch frische Präparate sehr hübsch auch makroskopisch demonstriren
lässt. Legt man mehrere Schnitte durch die Fossa capitis, entsprechend der
Richtung des Ligamentum teres, so kann man auch hier und da ein Gefässchen
eindringen sehen. Die oben beschriebenen Periostfalten, welche auf den Seiten
die Gefässe zum Kopfe führen, sind auch beim Neugeborenen schon gut
ausgebildet. Im Laufe des ersten Jahres legt sich ein Knochenkern im Kopfe an,
und nunmehr anastomosiren die von verschiedenen Seiten in den Kopf
übertretenden Gefässe mit einander, wie dies schon LANGER hervorhebt. Auch in
den folgenden Jahren (bis zum vierten) fand ich constant einige Gefässchen von
dem Ligamentum teres aus in den Kopf treten. Spätere Stadien konnte ich
mikroskopisch nicht mehr untersuchen. Dass ich beim Erwachsenen an der
Insertionsstelle des Bandes keine injicirten Gefässe fand, ist schon erwähnt.
1) Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und
Kniegelenks.
Auf Grund meiner Untersuchungen habe ich mir
folgende Ansichten über die Gefässverhältnisse des Ligamentum teres gebildet.
In Bezug auf die Gefässe verhält sich das runde Band wie ein Abschnitt der
Gelenkkapsel, indem es Gefässe zum Schenkelkopf führt wie die Periostfalten an
der medialen und lateralen Seite des Halses. Doch hat es eine mehr
untergeordnete Bedeutung wie diese, was daraus hervorgeht, dass die Zahl der
Gefässe geringer und der Zeitpunkt des Uebertritts eine viel späterer ist, als
bei den direct von der Kapsel kommenden Gefässen. Auch LANGER hält die Gefässe
des Bandes nur so lange für unentbehrlich, als sich noch kein Knochenkern,
bezw. Anastomose mit den übrigen Gefässen des Kopfes gebildet hat. Bis dahin
und noch einige Zeit später treten auch, wie wir gesehen haben, constant
Gefässe durch die Fossa capitis ein. Ob aber auch nur bis zur Bildung des
Knochenkerns diese Gefässe absolut nothwendig sind, scheint mir noch nicht
völlig sicher. Untersuchungen am Igel könnten da vielleicht entscheidend sein,
wenn es nämlich gelänge nachzuweisen, dass auch hier Gefässe während des
Bestehens des Ligamentum teres in den Kopf eindringen. Bei meinen Foeten, die
doch ein ziemlich vorgeschrittenes Stadium repräsentiren, war dies unmöglich.
In Bezug auf ihre Gefässe haben sowohl das
runde Band als auch die mehrfach erwähnten Perioststreifen dieselbe Bedeutung,
nämlich diese auf ihrem Weg zum Femur zu schützen. Ich will damit nicht sagen,
dass ich dies als die Function des Ligamentum teres betrachte, sondern nur
einen neuen Beweis für die Richtigkeit der Anschauung beibringen, dass das Band
einen Kapseltheil darstelle. Später schwinden sicher in einer grossen Zahl von
Fällen die Gefässe, denn jedenfalls werden sie zuerst von der Atrophie ergriffen,
welche sich so oft am Ansatzpunkte des Bandes einstellt. Schon die Torsion,
welche das Band beim Stehen und Gehen erleidet, ist gewiss für die Gefässe
nicht günstig. Auch habe ich beim Erwachsenen nur in der Hälfte der Fälle
Gefässöffnungen in der Fossa capitis gefunden. Ob aber diese noch immer von
Gefässen durchzogen waren, ist zweifelhaft, denn es können sehr wohl die
Gefässcanäle auch noch einige Zeit nach der Obliteration der Gefässe bestehen,
ganz abgesehen von den Fällen, wo das Ligamentum teres beim Erwachsenen fehlt.
Es führt uns also auch die Betrachtung der
Gefässverhältnisse zu der Auffassung des Bandes als eines Kapselabschnittes.
Vielleicht darf man auch aus der geringen Zahl und der späten Zeit des
Eintritts. dieser Gefässe auf die Bedeutungslosigkeit dieser Apparates
überhaupt schliessen. Jedenfalls ist die Blutzufuhr durch das Ligamentum teres
beim Erwachsenen völlig belanglos, wenn sie überhaupt stattfindet.
IV. Function und Theorie.
Bis jetzt haben wir nur die morphologische
Bedeutung des Ligamentum teres zu ermitteln gesucht, über die Function
desselben haben wir uns nur nebenbei ausgesprochen. Deshalb müssen wir im
Folgenden dieser Frage näher treten, zumal gerade über die Function des runden
Bandes die verschiedensten, z. T. sich völlig widersprechenden Ansichten
aufgestellt worden sind. Ehe ich aber darauf eingehe, möchte ich zeigen, dass
meine morphologische Erklärung des Ligamentum teres keineswegs ganz neu ist,
sondern, wenigstens theilweise, von anderen Autoren mehr oder minder deutlich
ausgesprochen worden ist. Im Anschlusse daran werde ich die anderen Ansichten
über die morphologische Bedeutung des runden Bandes kurz erwähnen.
WELCKER (1) war der erste, der auf Grund einer
Reihe von Untersuchungen, die schon früher erwähnt sind, zu der Annahme kam,
dass das Ligamentum teres von der Kapselwand aus in das Innere des Gelenkes
einwandere. Er brachte dafür eine Anzahl von Belegen aus der vergleichenden
Anatomie bei (Tapir, Seehund) und glaubte, dass auch die ontogenetische
Entwicklung beim Menschen eine ähnliche sei. Dass letzteres nicht zutrifft,
haben wir bereits gesehen. Warum aber das Ligamentum teres ein wandere, giebt
WELCKER nicht an. Er sagt nur: "Ich sehe das Treibende bei der Bildung des
Ligamentum teres in den einrückenden Fasern der äusseren, fibrösen Schicht der
Kapsel" (1. c. S. 79). Ihm schloss sich GEGENBAUR (2) an, der die
WELCKER'sche Ansicht erweiterte und folgendermassen formulirte: "Das
Ligamentum teres erscheint nicht als der Rest einer ursprünglichen Continuität
beider Contactflächen des Hüftgelenkes, sondern vielmehr als ein ursprünglich
ausserhalb des Gelenkes liegender Apparat, der erst mit der bei den Vögeln und
Säugethieren verlorenen, annähernd transversalen Stellung des Femur in das
Gelenk mit einbezogen wird und sich, wohl unter dem Einfluss der
Rotationsbewegungen des Femur, aus dem parietalen Zusammenhang löst."
Eigene Untersuchungen darüber sind, so viel ich weiss, von GEGENBAUR nicht
vorgenommen worden, dagegen wird durch meine Beobachtungen diese Theorie in
ihrem ganzen Umfange bestätigt.
Diese Einwanderungstheorie vertritt auch
SUTTON, (3) doch sucht er zugleich nachzuweisen, dass das Ligamentum teres die
ursprünglich extracapsulär gelegene Sehne des M. ambiens sei, die allmählich in
das Gelenk aufgenommen werde.
1) Ueber das Hüftgelenk. Zeitschr. f. Anat. u.
Entw. 1876.
2) Lehrbuch der Anatomie des Menschen S. 272.
3) The ligamentum teres. Journal of Anat. and
Phys. Vol. XVII.
Sutton hat sich bekanntlich in mehreren Arbeiten
(1) bemüht, eine ganze Reihe von Bändern auf Muskelsehnen zurückzuführen. In
der grössten Zahl der Fälle hat er auch sicher recht, in der Auffassung des
Ligamentum teres kann ich ihm jedoch nicht beistimmen. Sutton will nachweisen,
dass das Ligamentum teres "is nothing more than the tendon of the
pectineus muscle, separated from it in consequence of skeletal
modifications". Bezüglich der Einwanderung stellt er folgende Reihe auf:
Hatteria, Struthio, Equus, Homo. Bei Hatteria soll der M. ambiens, der nach dem
Autor dem M. pectineus der Säugethiere entspricht, mit zwei Sehnen entspringen,
mit der einen an der Spina lateralis pubis, mit der andern am Kopfe des Femur.
Ich habe schon früher darauf hingewiesen, dass letztere der vordere Schenkel
des Ligamentum accessorium ventrale ist, der zufällig bei Hatteria denselben
Ursprung hat wie der M. ambiens. Ein Blick auf Figur 10 macht dies sofort klar.
Bei den übrigen Reptilien variirt, wie wir durch GADOW (2) wissen, der Ursprung
der M. ambiens sehr, die Anordnung der Gelenkbänder bleibt dieselbe. Einen
Strauss konnte ich nur im Skelet untersuchen, wo er eine sehr tiefe Fossa
capitis zeigt. Auffallend ist jedoch, dass Rhea, Emu und Casuar wohl einen M.
ambiens, aber keine Fossa capitis besitzen. Auch GADOW (3) erwähnt nichts
davon, dass bei Struthio die Ursprungssehne des M. ambiens die Fortsetzung des
Ligamentum teres sei. Was das Pferd betrifft, so habe ich schon gezeigt, dass
der vom Bauche zum Hüftgelenk ziehende Sehnenstrang vom eigentlichen Ligamentum
teres zu trennen ist, das daneben kräftig entwickelt ist. Ferner entspricht.
der M. pectineus der Säugethiere nicht dem M. ambiens der Reptilien. und Vögel
(GADOW (3), PATERSON (4)) und vollends nicht der des Pferdes, der ein
complicirtes Gebilde ist, das sich aus zwei Muskeln zusammensetzt. Nur darin
stimme ich mit Sutton überein, dass der bei Hatteria beschriebene Strang einen
Theil des späteren Ligamentum teres bildet und als solcher in das Gelenk
einwandert. Ich wäre auf die Theorie Suttons nicht so genau eingegangen, wenn
sie nicht in verschiedene Lehrbücher aufgenommen worden wäre. So schreibt
TESTUT (5): "Nous le voyons (le ligament rond) encore chez quelques
vertébrés inférieures, notamment chez l'autruche et chez le sphenodon se
continuer directement avec un corps musculaire qui est l'homologue de notre
pectiné."
1) The nature of ligaments. Journal of Anat.
and Phys. Vol. XVIII, XIX u. XX.
2) Beiträge zur Myologie der hinteren
Extremität der Reptilien. Morph. Jahrb. Bd. VII.
3) Zur vergleichenden Anatomie der Musculatur
des Beckens und der hinteren Gliedmassen der Ratiten. Jena 1880.
4) The pectineus muscle and its nerve-supply.
Journal of Anat. and Phys. Oct. 1891 S. 43.
5) Traité d'anatomie humaine. T. I. 1890.
DEBIERRE (1) vollends sagt: "ce n'est que le tendon d'un
muscle pelvifemorale disparu."
Auch
MORRIS (2) schliesst sich der Sutton'schen Theorie an, will aber daraus auch
die Function des Ligamentum teres erklären. Bei Struthio und Equus würde durch
die Conctration des M. ambiens bezw. pectineus das Band gespannt und so eine
Aussenrotation mit Abduction bei der Beugung des Oberschenkels verhindert. Das
Band hemmt also gerade die Bewegung, welche durch die Contraction des Muskels
erzielt wird. Beim Elephant und Seehund kann nach Morris das Band fehlen, weil
die Bewegung, die es hemmt, bei diesen Thieren unmöglich ist.
Nach
BUISSON (3) ist es:,,simplement un ligament intra-articulaire, destiné à unir
les surfaces articulaires et à les maintenir dans leurs rapports
naturels". Es ist nur dann nothwendig und vorhanden, wenn die Pfanne
lateralwärts sieht. Bei nach abwärts gerichteter Pfanne, wie sie nach BUISSON
bei Elephant, Orang und bei den Sauriern vorkommt, wird die Körperlast direct
auf die Extremitäten übertragen und so der Contact der Gelenkflächen erhalten.
Diese Ansicht ist gar nicht haltbar. Denn erstens sieht beim Orang und bei den
Reptilien die Gelenkpfanne nicht nach abwärts, zweitens wird dadurch nicht das
Fehlen bei vielen Säugethieren mit sonst normalem Gelenke erklärt und drittens
ist das wandständige Ligamentum teres gar nicht beachtet.
Ausser
diesen allgemeinen Theorien über das Ligamentum teres sind noch mehrfach
Hypothesen aufgestellt worden, welche das Fehlen des Bandes, namentlich beim
Elephant und Orang, erklären sollten. Schon OWEN (4) brachte den Mangel des
Bandes beim Elephant und Megatherium in Beziehung zur Lage der Gelenkflächen,
indem hier die Pfanne von oben her den Schenkelkopf umfasse und ihn nicht
seitlich. aufnehme wie bei den übrigen Säugethieren. SAVORY (5) fügt dem noch
hinzu, das Band könne hier fehlen, weil das Körpergewicht direct auf das
Centrum des Gelenkes übertragen werde. Die Thatsache ist richtig, aber die
Erklärung falsch. Nicht weil es hier zur Uebertragung der Körperlast
überflüssig ist, fehlt das Band, sondern weil Pfanne und Kopf die
ursprünglichen Lagebeziehungen beibehalten haben, ist es nicht zur Einwanderung
des Bandes gekommen.
1)
Traité élémentaire d'anatomie 1890, T. I S. 217.
2) The ligamentum teres. British med. Journal 1882.
3)
Contribution à l'étude des fonctions du ligament rond. Thèse de Bordeaux 1888.
4)
On the osteology of the Chimpanzee and Orang.
5) On the ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Bd. VIII.
HUMPHRY
(6) sagt: ,,Wenn die untere Extremität senkrecht vom Becken absteigt oder sich
etwas nach aussen neigt, fehlt das Band, wie beim Elephanten, Seehund und bei
der Schildkröte. (1) Für letztere beide Thiere stimmt die Erklärung, aber
nimmermehr darf mit ihnen der Elephant zusammengestellt werden und noch weniger
der Orang. Die Pfanne des Orang unterscheidet sich von der der übrigen
Quadrumanen gar nicht, wie das OWEN (2) richtig hervorhebt, der deshalb auch
nach einer anderen Erklärung sucht und den Mangel des Bandes beim Orang "zweifellos"
in Beziehung zu der unverhältnissmässigen Kürze seiner hinteren Extremitäten
treten lässt. Durch das Fehlen des Bandes sei einerseits eine grössere
Beweglichkeit des Hüftgelenks, namentlich bei der Innenrotation, möglich,
andrerseits sei dadurch der schwankende Gang der Thieres bedingt, wenn es sich
auf zwei Beinen fortbewegt. Wir wissen, dass das Ligamentum teres dem Orang in
der Regel fehlt, weil es nicht mehr zur Anlage kommt oder frühzeitig resorbirt
wird, und dass der wackelige Gang durch den Bau des Fusses verursacht wird.
6)
On the human skeleton 1858.
1) Aber nicht, weil
dann die hinteren Extremitäten weniger vom Körpergewicht zu tragen haben, denn
die Fledermäuse besitzen das Band (Humphry, Journ. of Anat. and Phys. Vol. III
S. 312).
2) On the osteologyof the Chimpanzee and Orang.
Alle übrigen Theorien beschäftigen sich nur mit der Function des Ligamentum teres beim Menschen. Eine grosse Zahl derselben können wir unter dem Namen der mechanischen Theorien im Zusammenhang besprechen. Darnach soll nämlich das Ligamentum teres entweder bei der Uebertragung der Körperlast auf die Beine in Wirksamkeit treten oder es soll die Bewegungen des Oberschenkels in gewissem Sinne beeinflussen. Alle diese Hypothesen wurden entweder auf die Lage des Bandes überhaupt gegründet oder auf die Beobachtung, dass das Ligament sich bei gewissen Bewegungen des Femur stark anspanne, oder dass nach seiner Durchtrennung bestimmte Bewegungen an Excursion gewinnen. Nach GERDY (3) soll das Band die Adduction. des Oberschenkels hemmen, eine Ansicht, die auch die Gebrüder WEBER (4) aufstellen. Letztere sagen: "Wenn man aufrecht steht und die Beine einander zu nähern sucht, so bemerkt man, dass man zwar beide Kniee zur Berührung bringen, aber ohne sie zu beugen nicht fest aneinander pressen kann, dass dieses aber sogleich mit grosser Leichtigkeit geht, sobald man das Hüftgelenk etwas beugt. Der Umfang der Adduction. ist nämlich in der gebogenen Lage des Hüftgelenks grösser, so dass die Beine alsdann nicht nur völlig einander genähert, sondern auch übereinander geschlagen und gekreuzt werden können. Sie wird aber bei zunehmender Streckung immer kleiner und geht bei aufrechter Stellung sehr wenig über die senkrechte Lage des Beines hinaus. Diese Beschränkung der Adduction in der gestreckten Lage des Körpers wird durch zwei Bänder, das Ligamentum superius und das Ligamentum teres, bewirkt, die sich am Hüftgelenk diametral gegenüber liegen. Es ist dies an einem Durchschnitt des Beckens deutlich, der der Ebene parallel ist, in welcher jene Bewegung geschieht. Man sieht alsdann, dass beide Bänder parallel der Durschschnittsebene laufen und beide nur durch die Annäherung der Knochen in dieser Ebene gespannt werden. können. Die Beschränkung der Adduction des Schenkels oder der seitlichen Bewegung des Hüftgelenks, welche vom Ligamentum teres und Ligamentum superius herrührt, ist darum für das Gehen von grosser Wichtigkeit, weil der Schwerpunkt des Körpers, welcher in die Mitte zwischen beide Oberschenkel fällt, bei dieser Bewegung bald von dem einen, bald von dem andern Kopfe allein unterstützt und alsdann nur theilweise getragen wird; der nicht getragene Theil der Körperlast würde daher den Rumpf nach innen und unten um den Schenkelkopf drehen, und folglich fallen, wenn nicht jene Bänder durch ihre Spannung diese Drehung verhinderten."
3) Étude sur lamarche. Journal de Magendie 1829. (See note)
Eine ähnliche
Ansicht vertreten TURNER (1) und SAVORY. (2) Letzterer geht von der
Vorbedingung aus, dass das Ligamentum teres beim aufrechten Stehen sowohl auf
beiden Beinen, als auch besonders auf einem Beine gespannt ist. Diese Thatsache
will er durch die in ihrem Grunde trepanirte Pfanne beobachtet haben. Das Band
sei demnach am stärksten gespannt, wenn das Hüftgelenk die grösste Last zu
tragen habe (beim Stehen auf einem Fusse). Die Hauptfunction des Bandes sei
deshalb, zu starken Druck zwischen dem oberen Theil des Acetabulum und der
entsprechenden Fläche des Kopfes zu verhindern. Das Resultat davon ist dann: "When
the person is erect the body partly hangs upon the Ligamentum teres."
Gegen diese Ansicht trat HUMPHRY (3) auf, indem er die Voraussetzung bestritt, auf die sie gegründet war. Vor ihm hatte aber schon STRUTHERS (4) ähnliche Beobachtungen gemacht und war zu folgendem Ergebniss gekommen: "The function and the only function of the ligamentum teres is to check rotation outwards in the flexed position." Beide Autoren stützen ihre Ansicht nicht nur durch directe Beobachtung, sondern auch durch nachstehende Folgerung. An die Grube zur Insertion des runden Bandes schliesst sich noch eine kleine mehr oder minder deutliche Rinne an, welche nach hinten unten gerichtet ist. Diese Rinne soll durch den Druck des Ligamentum teres auf den Kopf entstehen, und das Band hätte demnach die grösste Spannung, wenn es in dieser Grube liegt. Dies ist aber bei mittlerer Beugung von etwa 45° der Fall. Doch die Beugung allein genügt noch nicht, um das Band zu spannen, es muss noch Adduction oder Aussenrotation des Femur hinzukommen. Demnach wäre die Function des Bandes, bei mittlerer Beugung verbunden mit Adduction oder Aussenrotation, einen Theil des Körpergewichts zu tragen.
1) Human Anatomy and Physiology. Edinburgh 1857 S. 42.
2) On the ligamentum teres. Journ. of Anat. and Phys. Vol. VIII.
3) On the human skeleton including the joints 1858 und Journal of Anat. and Phys. Vol. VIII S.
295.
4) On the truefunction of the round ligament of the hip-joint. Lancet. 1863.
Auch H. MEYER (1)
schliesst sich dieser Auffassung an: "Die Richtung der Rinne (des
Schenkelkopfes) ist dieselbe wie diejenige der Axe des Femurhalses. Es ist
keinem Zweifel unterworfen, dass die Rinne ihre Entstehung dem Seitendruck des
gespannten Bandes verdankt, und es ist daher der Schluss gestattet, dass das
Band am meisten gespannt, dann also in seiner functionell wichtigen Lage sich
befindet, wenn es in dieser Rinne gelegen ist. Untersucht man nun an einem
Präparat, welche Stellung des Femur einer solchen Lage des Bandes entspricht,
so findet man, dass dies eine solche Flexion des Femur ist, bei welcher das
Collum femoris in der Richtung desjenigen Pfannenradius gestellt ist, welcher
durch den hinteren Theil der Incisura acetabuli geht. Für die Spannung des
Bandes ist dabei übrigens noch eine Rotation nach aussen nothwendig. - Man
sieht also daraus, dass das Ligamentum teres bei flectirter Stellung des Femur
hemmend für die Rotation nach aussen wirkt." Doch wird die Hemmung durch
das Ligamentum teres durch die Spannung des Lig. ilio-femorale unterstützt.
Nach HENKE (2)
spannt sich das Ligamentum teres an bei Adduction in gestreckter und
Aussenrotation in gebeugter Stellung des Femur. "Erstere wird bereits
anderweitig gehemmt, ehe es zur Spannung des Ligamentum teres kommt, für
letztere kann dieselbe abschliessend wirken, z. B. wenn man den Fuss auf das
andere Knie legt."
Was die Rinne im
Schenkelkopf betrifft, so habe ich nachgewiesen, dass sie ihre Richtung der
foetalen Stellung des Hüftgelenks verdankt, bei der Anlage viel tiefer ist und
im Laufe des Wachsthums seichter wird, ja ganz verschwinden kann.
Drückt sich schon MEYER vorsichtig aus, indem er sagt, dass das Lig. ilio-femorale dieselben Bewegungen hemme wie das Lig. teres, so sind andere Autoren noch weiter gegangen und lassen die ganze angebliche Hemmungsthätigkeit des runden Bandes durch das Ligamentum ilio-femorale ausführen, während sie dem Ligamentum teres jede mechanische Function absprechen. Schon HYRTL (3) giebt an, dass das Lig. teres nur "geringen Antheil" an der Hemmungswirkung hat, die vorzugsweise vom Lig. ilio-femorale ausgeführt wird. HENLE, (4) der ebenfalls Untersuchungen bei trepanirter Pfanne vorgenommen hat, kommt zu dem Resultate: "Dass das Ligamentum teres in die Be wegungen des Hüftgelenks irgendwie hemmend eingreift, muss ich bestreiten." Ihm schliessen sich WELCKER, LUSCHKA, LANGER und die meisten neueren Autoren an.
1) Statik und Mechanik des menschlichen Knochengerüstes. Leipzig 1873. S. 343.
2) Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke 1863 S. 210.
3) Topographische Anatomie Bd. II.
4) Lehrbuch der systematischen Anatomie Bd. I.
Auch ich habe diese
Untersuchungen nachgemacht und kann meine Ergebnisse kurz zusammenfassen. Um die
Spannung des Bandes bei den verschiedenen Stellungen zu prüfen, schlingt man es
nach Trepanation der Pfanne am besten mit einem Faden an, bei dessen Anziehen
man den Grad der Spannung erkennt. Bei erhaltenen Muskeln gelang es mir nicht
eine Stellung des Femur ausfindig zu machen, in der sich das Band überhaupt nur
fest an den Kopf anlegt. Es tritt immer vorher Muskelhemmung ein. Sind die
Muskeln rings um das Gelenk abgetragen, so kann man durch Aussenrotation des
gebeugten Femur das Band allerdings in eine gewisse Spannung versetzen, doch
ist sie nicht stark und jedenfalls keine abschliessende Hemmung, was daraus
hervorgeht, dass nach Durchtrennung des Bandes die angegebene Bewegung des
Femur nicht grösser wird, wohl aber nach Section des Ligamentum ilio-femorale
bedeutend zunimmt. Durch einfache Adduction konnte ich nie Spannung des
Ligamentum teres erzielen. Auch die überaus variable Länge und Stärke des
Ligamentum teres im erwachsenen Zustande spricht gegen irgend welche
mechanische Function desselben. Im Durchschnitt ist das Lig. teres etwa 25 mm
lang; gelegentlich trifft man kürzere Bänder, die dann vielleicht auch schon
bei extremer Adduction eine gewisse Spannung erreichen, häufiger aber längere.
Ich habe solche bis zu 40 mm Länge gemessen, die sich bei keiner Bewegung des
Gelenks anspannten. Auch die häufig vorkommende ausserordentliche Schwäche,
sowie der gar nicht seltene vollkommene Mangel des Bandes sprechen für die
mechanische Bedeutungslosigkeit dieses Apparates.
Eine andere mechanische Theorie stellte in neuester Zeit TILLAUX (1) auf. Nach ihm ist das Band eine Schutzvorrichtung, welche zusammen mit dem fetthaltigen Bindegewebe der Fossa acetabuli bei Fall auf den Trochanter major den Grund der Pfanne vor Perforation schützt, indem es sich wie ein elastischer Puffer zwischen die beiden aufeinander gepressten Knochenflächen schiebt. "C'est un ligament d'arrêt; il s'oppose à ce que la tête vienne peser par son sommet sur le fond de la cavité cotyloide."
1) Traité d'anatomie topographique.
Ausser dem directen
Widerstande, den das Band leistet, soll es jedoch noch in anderer Weise diesen
Zweck erfüllen. In Folge seiner excentrischen Insertion am Kopfe soll es
diesen, wenn er durch den Pfannenboden zu dringen versucht, etwas von der
geraden Linie ablenken und so die Stärke des Stosses mildern und ihn auf die
Superficies auricularis übertragen. Ich kann mir offen gestanden dieses "mouvement
de bascule modifiant les rapports des sur faces articulaires", das doch
offenbar mit einer leichten Abduction des Oberschenkels verbunden sein muss,
bei einem Falle auf den Trochanter nicht vorstellen. Ausserdem aber halte ich
es auch für vollkommen unnöthig. In Folge der Halbkugelgestalt von Kopf und
Pfanne wird bei einem Stoss oder Fall auf den Trochanter schon ganz von selbst
die Wucht der Einwirkung auf den ganzen Umkreis der Pfanne und nicht auf ihren
Grund übertragen. Giebt es doch Thiere, bei denen der Boden der Pfanne
physiologisch durchbrochen ist. Trotzdem kommt LESSHAFT (1) zu einer ganz
ähnlichen Ansicht: "Auf Frontalschnitten, durch die Mitte des Gelenkkopfes
geführt, ist ganz gut zu sehen, dass das Ligamentum teres in vertikaler
Richtung im unteren Theil der Pfanne gelagert ist, unter dem Theil, welcher
hauptsächlich die Schwere des Beckengewölbes zu tragen hat. Ohne die Stärke der
Stütze zu beeinträchtigen, kann hier ein weniger festes, aber dafür elastisches
Gewebe (wie Fett, Gefässe, Synovia, Synovialmembran) gelagert sein, welches bei
grösseren Berührungsflächen die Wirkung der Erschütterungen und Stösse mildert.
Das Hüftgelenk ist daher ein complicirtes Gelenk, in welchem zur Minderung der
Erschütterungen und Stösse zwischen den grossen Berührungsflächen Synovia,
besonders entsprechend dem Rand der knöchernen Pfanne, und Synovialfalten und
Fortsätze als Ligamentum teres und in der Umgebung des Schenkelhalses und an
der innern Oberfläche der Kapsel gelagert sind. Das Ligament ist mit seinem
oberen Ende am Schenkelkopf befestigt, um bei den Bewegungen im Gelenke seine
Lage besser zu bewahren. Die im Ligament gelagerten Gefässe entsprechen
überhaupt den in grösseren Synovialfalten und Fortsätzen vorkommenden
Gefässen." In Wirklichkeit übt wohl der elastische Gelenkknorpel diese
dämpfende Wirkung viel vollkommener aus als das Bindegewebe.
Wenn ich der Vollständigkeit und Curiosität halber noch zwei Ansichten von GERDY (2) und von WALBAUM (3) erwähne, können wir die mechanischen Theorien über das Ligamentum teres verlassen. Ersterer meint, das Band begünstige in Folge seiner Anordnung bei gewissen Bewegungen eine Luxation des Oberschenkels, letzterer glaubt, seinen Hauptzweck habe das Band in der Foetalzeit zu erfüllen, wo der Kopf ziemlich weit nach hinten und aussen die Pfanne überragt, indem es eine Luxation nach dieser Richtung verhindern soll. Ein Wort der Widerlegung braucht diesen Theorien gegenüber nicht verschwendet zu werden.
1) Ueber
Vorrichtungen in den Gelenken zur Milderung etc. Anat. Anzeiger 1886.
2) Étude sur lesmarche. Journal de Magendie 1829. (See note)
3) De arteriis articulationis coxae. Diss. Lipsiae 1855.
Die noch übrigen
Hypothesen über das Ligamentum teres lassen sich nicht unter einem gemeinsamen
Gesichtspunkt behandeln. Einige haben die Gefässverhältnisse im Bande zur
Voraussetzung. Es ist hier der zuerst von PALETTA (1) ausgesprochenen und dann
von SAPPEY (2) weiter ausgebildeten Theorie zu gedenken, wonach das Ligamentum
teres Leitband für die Ernährungsgefässe des Schenkelkopfes ist, eine Ansicht,
die namentlich unter den Chirurgen vielen Anklang gefunden hat. Wir haben schon
früher gesehen, dass nur in der Foetalzeit und in der Kindheit constant Gefässe
aus dem Ligamentum teres in den Kopf übergehen, dass die Haupternährung des
Kopfes durch Gefässe geschieht, die vom Halse aus in den Kopf übertreten, dass
die vom Bande aus eindringenden Gefässe nur bis zur Anlage des Knochenkerns.
Bedeutung haben und dass nur bei etwa der Hälfte der Erwachsenen noch
Gefässporen im Schenkelkopf nachzuweisen sind. Einige Autoren (HYRTL, (3) NUHN
(4) leugnen ja überhaupt den Uebergang von Gefässen von dem Bande in den Kopf.
Eine wesentliche Bedeutung haben jedenfalls die paar in der Fossa capitis
einmündenden Gefässe für den Erwachsenen nicht. Deshalb gelangten mehrere
Untersucher (NUHN, HENLE (5) dazu, das Ligamentum teres blos als
Synovialduplicatur zu betrachten und seine Function in der Bildung von Synovia
zu suchen. Jedenfalls ist die Thatsache richtig, dass es ein Synovia
bereitendes Organ ist, aber die eigenthümliche Anordnung dieses Apparates ist
damit nicht erklärt.
Eine eigenartige
Theorie, die aber nirgends Zustimmung gefunden hat, vertritt WELCKER. (6) Nach
ihm hat das Ligamentum teres die "Umtreibung der Synovia" im Gelenk
zu besorgen. Zur Stütze seiner Ansicht sucht Welcker nach ähnlichen
Einrichtungen in anderen Gelenken und glaubt sie in der Bicepssehne des
Schultergelenks und in den Menisken des Knies gefunden zu haben. Es ist jedoch
nicht einzusehen, warum zur Befeuchtung der Gelenkflächen, wozu doch sicher die
einfache Capillarität genügt, ein so complicirter Mechanismus angebracht sei.
Auch wäre es dann höchst auffallend, warum diese Einrichtung nicht allen
Säugethieren zu Gute kommen sollte, da wir doch wissen, dass sie einer ganzen
Reihe von Thieren fehlt, ohne dass wir einen anderen Apparat fänden, der an
ihrer Stelle die Synovia in Bewegung setzte.
Wenn wir nach dieser kurzen Uebersicht der bis jetzt ausgesprochenen Theorien über das Ligamentum teres, auch unsere Ansicht aussprechen sollen, so ist es die, dass das Lig. teres functionslos ist. Es ist ursprünglich ein Kapselabschnitt, der aber mit seiner Aufnahme in das Gelenk seine Bedeutung verloren hat. In Bezug auf die Gefässe verhält es sich wie die zu beiden Seiten an den Kopf herantretenden Synovial- und Perioststreifen, nur dass diese ihre Function, dem Schenkelkopf Blut zuzuführen, in viel ausgedehnterem Maasse und zeitlebens erfüllen, während das Ligamentum teres ein atrophisches Organ ist.
1) Exercitiones pathologicae. Mediolani 1820.
2) Traité d'anatomie descriptive Bd. I.
3) Topographische Anatomie Bd. II.
4) Lehrbuch der
praktischen Anatomie 1882.
5) Lehrbuch der systematischen Anatomie Bd. I.
6) Ueber das Hüftgelenk. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1876.
Zum Schlusse sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. SCHWALBE, für die Anregung zu dieser Arbeit und den vielfachen Rath bei ihrer Ausführung auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
Literaturverzeichniss.
1) AEBY: Die
Umformung des Schulter- und Hüftgelenks. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd.
II.
2) AEBY: Der Baudes menschlichen Körpers. Leipzig 1871.
3) VON AMMON: Die angeborenen
chirurgischen Krankheiten des Menschen.
4) BEAUNIS et
BOUCHARD: Nouveaux éléments d'anatomie descriptive. Paris 1880.
5) BERNAYS: Die
Entwicklungsgeschichte des Kniegelenkes des Menschen. Morph. Jahrb. Bd. IV.
6) BUISSON:
Contribution à l'étude des fonctions du ligament rond de l'articulation
coxo-fémorale. Thèse de Bordeaux 1888.
7) CAMPER: Histoire
naturelle. T. I.
8) DEBIERRE: Traité
élémentaire d'anatomie 1890. T. I.
9) FICK: Zur
Mechanik des Hüftgelenks. Arch. f. Anat. u. Phys. 1878.
10) GADOW: Zur
vergleichenden Anatomie der Musculatur des Beckens. und der hinteren Gliedmassen
der Ratiten. Jena 1880.
11) GADOW: Beiträge
zur Myologie der hinteren Extremität der Reptilien. Morph. Jahrb. VII.
12) GEGENBAUR:
Ueber den Ausschluss des Schambeins von der Pfanne des Hüftgelenks. Morph.
Jahrb. Bd. II.
13) GEGENBAUR:
Lehrbuch der Anatomie des Menschen.
14) GERDY: Étudesur la marche. Journal de Magendie 1829. (See note)
15) HARTMANN:
Lehrbuch der Anatomie des Menschen 1881.
16) HENLE: Lehrbuchder systematischen Anatomie Bd. I.
17) HENKE und REYHER: Studien über die Entwicklung der Extremitäten. Sitzungsberichte der
Wiener Akademie Bd. LXX 3. Abth.
18) HENKE: Handbuchder Anatomie und Mechanik der Gelenke.
19) HUMPHRY: On the human skeleton including the joints 1858.
20) HYRTL: Handbuchder topographischen Anatomie 7. Aufl. II. Bd. 1882.
21) HYRTL: Beiträge
zur angewandten Anatomie des Hüftgelenks. Zeitschrift der k. k. Gesellschaft
der Aerzte zu Wien. 1846 Bd. I.
22) KRAUSE:
Handbuch der menschlichen Anatomie.
23) LANGER: Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie 1885.
24) LANGER: Ueber
das Gefässsystem der Röhrenknochen. Denkschriften der Wiener Akademie Bd.
XXXVI.
25) LECHE: Zur
Anatomie der Beckenregion der Insectivoren. Konliga svenska
vetenskaps-akademiens handlingar 1882/83.
26) LEISERING:
Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haussäugethiere. 1890.
27) LESSHAFT: Ueber
die Vorrichtungen in den Gelenken zur Milderung etc. Anat. Anz. 1886.
28) LUCAE: Die
Robbe und Otter. Abhandlungen der Senkenberg'schen Gesellschaft 1872.
29) LUSCHKA: Die Anatomie des Menschen Bd. III 1. Abth.
30) MECKEL:
Ornithorhynchi paradoxi descriptio anatomica 1826.
31) MECKEL: System
der vergleichenden Anatomie Bd. II Abth. 2.
32) MEYER: Lehrbuchder physiologischen Anatomie.
33) MEYER: Statikund Mechanik des menschlichen Körpers. 1873.
34) MIVART: On the skeleton of the
primates. Transactions of the zoological society of London Vol. VI.
35) MOREL et DUVAL:
Manuel de l'anatomie 1883.
36) MORRIS: The
anatomy of the joints of man. London 1879.
37) MORRIS: The
ligamentum teres and his uses in man and animals. Brit. med. Journal 1882.
38) NUHN: Lehrbuch
der praktischen Anatomie 1882.
39) OWEN: On theosteology of the Chimpanzee and Orang. Transactions of the zoological society
of London Vol. I.
40) PALETTA: Exercitationes pathologicae. Mediolani 1820.
41) PALETTA:
Deutsches Archiv für Physiologie von Meckel 1820.
42) PATERSON: The
pectineus muscle and its nerve-supply. Journ. of Anat. and Phys. Oct. 1891.
43) SAPPEY: Traité d'anatomie descriptive T. I.
44) SAVORY: On the ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. VIII.
45) SCHUSTER: Zur Entwicklung des Hüft- und Kniegelenks. Mittheilungen aus dem Wiener
embryologischen Institut Bd. I 1880.
46) STRUTHERS: On the true function of the round ligament of the hip-joint. Lancet 1863.
47) SUTTON: The
ligamentum teres. Journal of Anat. and Phys. Vol. XVII.
48) SUTTON: The
nature of ligaments. Journal of Anat. and Phys. Vol. XVIII, XIX u. XX.
49) TESTUT: Les
anomalies musculaires chez l'homme. Bordeaux 1882.
50) TESTUT: Traité
d'anatomie humaine T. I 1889.
51) TILLAUX: Traité
d'anatomie topographique 1882.
52) VARIOT:
Développement des cavités et des moyens d'union des articulations. Thèse pour
l'agrégation. Paris 1883.
53) WALBAUM: De arteriis articulationis coxae. Diss. Lipsiae 1855.
54) WEBER, W. u. E.: Mechanik der Gehwerkzeuge.
55) WELCKER: Ueber das Hüftgelenk. Zeitschrift für Anat. u. Entw. 1876.
56) WELCKER:
Nachweis eines Lig. interarticulare humeri. Zeitschr. f. Anat. u. Entw. 1877.
57) WELCKER: Zur
Anatomie des Lig. teres. Zeitschrift f. Anat. u. Entw. 1877.
58) WELCKER: Zur Einwanderung der Bicepssehne. Arch. f. Anat. u. Phys. 1878.
Erklärung
der Abbildungen.
L. t. = Ligamentum
teres .
Taf.
IV.
Fig. 1. Schnitt
durch das Hüftgelenk eines menschlichen Embryo von nicht ganz 30 mm. Steiss-Scheitellänge;
Schnittführung parallel der Längsaxe beider Oberschenkel.
Fig. 2. Schnitt
durch das Hüftgelenk parallel dem Lig. teres von einem menschlichen Embryo von
34 mm Steiss-Scheitellänge.
Fig. 3. Schnitt
senkrecht zum Verlauf des Lig. teres von einem menschlichen Embryo von 47 mm
Steiss-Scheitellänge.
Fig. 4. Schnitt
parallel zum Verlauf des Lig. teres von einem menschlichen Embryo von 47 mm
Steiss-Scheitellänge.
Fig. 5.
Längsschnitt durch das Hüftgelenk eines Igelembryo von 45 mm Länge.
Fig. 6. Becken von
Emys lutaria.
Fig. 7. Femur von Emys lutaria von vorn.
Fig. 8. Becken vom
Alligator. Il. = Ilium, Pub. = Pubis, Isch. = Ischium.
Fig. 9. Femur vom
Alligator von der Seite.
Fig. 10. Hüftgelenk
von Hatteria. M. amb. = M. ambiens.
Fig. 11. Linkes
Hüftgelenk vom Alligator von der ventralen Seite mit den beiden Schenkeln des
Lig. acc. ventrale.
Fig. 12. Becken von
Ornithorhynchus paradoxus. Linke Seite.
Fig. 13. Linkes Femur von Ornithorhynchus paradoxus.
Fig. 14. Linkes Femur von Phoca von hinten.
Fig. 15. Linkes Femur von Lutra von hinten.
Fig. 16. Linkes Femur von Meles taxus von hinten.
Fig. 17. Hüftgelenk von Lutra mit wandständigem Lig. teres.
Fig. 18. 1. Präparat zur Demonstration des Lig. pubo-femorale des Pferdes.
M. rect. abd. = M. rectus abdominis (durchtrennt).
M. grac. = M. gracilis (durchtrennt).
M. pect. = M. pectineus (pubo-femoralis).
Fig. 19. 2. Präparat zur Demonstration des Lig. pubo-femorale. Der M.
gracilis ist zurückgeschlagen, der M. pectineus von seiner Insertion losgelöst
und zur Seite geschoben.
M. grac. = M. gracilis.
M. pect. = M. pectineus.
L. pub. fem. = Lig. pubo-femorale.
Taf. V.
Fig. 20. Becken des Elephanten.
Fig. 21. Femur des Elephanten, oberer Abschnitt.
Fig. 22. Becken vom Rhinoceros.
Fig. 23. Femur vom Rhinoceros, oberer Abschnitt.
Fig. 24. Becken von Hyrax.
Fig. 25. Femur von Hyrax, oberer Abschnitt.
Fig. 26. Becken vom Tapir.
Fig. 27. Femur vom Tapir, oberer Abschnitt.
Note
We have read the article by P.N. Gerdy «Étude sur lesmarche. Journal de Magendie 1829" (Gerdy PN. Mémoire sur le mécanisme de la marche de l'homme. Journal de Physiologie Experimentale et pathologique par F. Magendie. 1829;9(1):1-28. [books.google]). Unfortunately, no information about LCF was found in this publication. Perhaps E. Moser means the earlier book 1823GerdyPN.
External links
Moser E. Ueber das Ligamentum teres des Hüftgelenks. Morphologische
Arbeiten. 1893;2(1)36-92. [books.google , jstor.org]
Authors & Affiliations
E. Moser, assistant at the anatomical institute in
Strasbourg.
Keywords
ligamentum capitis femoris, ligamentum
teres, ligament of head of femur, anatomy, role, significance, biomechanics,
NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7
REVIEWS AND CLASSIFICATIONS
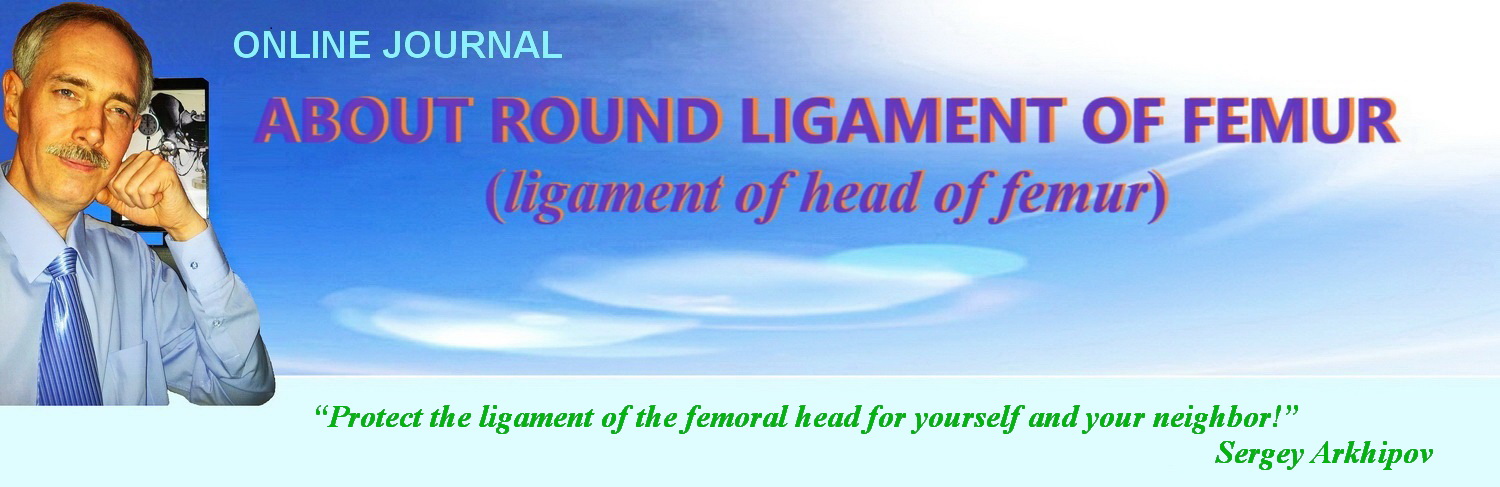






Comments
Post a Comment