The article
discusses the embryonic development of the ligamentum capitis femoris
(LCF) in humans
and individual animals. The text is
prepared for machine translation using a service built into the blog from
Google or your web browser. In some cases, we have added links to quotations
about LCF available on our resource, as well as to publications posted on the
Internet.
Zur
Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenkes.
Von Dr.
H. Schuster in Wien.
(Hiezu Taf. XVI, XVII.)
Die Frage der Gelenksentwicklung in ihrer
heutigen Form und Fassung gestattet wohl schon eine fragmentarische Behandlung
einzelner Acte der embryonalen Gelenksbildung. Sieht man hierbei ab vom
typischen Entwicklungsgang der Skeletgliederung, als von einer bis heute nicht
endgiltig gelösten und nur durch die Histogenese zu beantwortenden Frage, so
befinden wir uns schon auf dem durch Henle (1855) und Luschka (1) geschaffenen,
von Reyher und Henke (2) weiter bearbeiteten Boden.
Die Arbeiten v. Baer's (3) Rathke's (4) und Bruch's (5) liefern für unseren begrenzten Arbeitsstoff nur wenige Anhaltspunkte.
1) „Die Halbgelenke“ etc. 1858.
2) „Studium über Entwicklung der Extremitätendes Menschen, insbesondere der Gelenkflächen“. Sitzgb. der k. Akademie der
Wissenschaften. LXIX. Bd. III. Abth. 1874.
3) „Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere“. I. und II. Theil Königsb. 1828 und 1837.
4) „Entwicklungsgeschichte der Wirbelth“. Entwicklungsgesch. der Schildkröten". Braunschw. 1848. „Untersuchungen über d. Entwicklung und Körperbau d. Krokodile". „Entwicklg. d. Natter". Königsb. 1839.
5) „Beiträge z. Ent. d. Knochensystemes“. N. Denkschr. d. schweiz. Ges. f. d. ges. Naturwiss. Zürich 1852 Bd. XII.
Erst durch Luschka's Beobachtungen an den
letzten Zehengelenken, namentlich der fünften Zehe menschlicher Embryonen,
gelangen wir zur Kenntniss einer die primordialen, knorpeligen Skelettheile
verbindenden Zwischenzone - als Trennungs- und Bindemittel der primordialen
Gelenkskörper. Die Eintheilung der Gelenke in solide, hohle und Halbgelenke ist
eben nur eine Uebertragung und Durchführung, von der Embryologie entnommenen
Thatsachen.
Henke und Reyher geben bei der Beschreibung der
Zwischensubstanzen an: „dass sich zwischen den ersten Interphalangealgelenken
durch Pikrocarmin gelbfärbende Scheiben finden, während an den zweiten und
dritten Interphalangealgelenken die einzelnen Gliedabschnitte durch roth
gefärbte Linien von einander getrennt sind.“ – Sie halten „diese intensiven
Roth- und Gelb farbungen für den Ausdruck des Grades der histologischen
Sonderung, der Entwicklung von Knorpel und das Auftreten von
Intercellularsubstanz.“
Nachdem man es versuchte, diese zumeist an den
kleinen peripherischen Gelenken der Extremitäten gemachten Beobachtungen auf
die grossen Hohlgelenke mit complicirterem Bau zu übertragen, blieb die
Entstehung vieler diese Gelenke charakterisirenden Gebilde bis heute unaufgeklärt.
Die Zwischenzonen der grossen Hohlgelenke,
bieten aber in Bezug auf Anlage, fortschreitende Entwicklung und ihr Verhalten
zur unmittelbaren Umgebung, wohl zu berücksichtigende Verschiedenheiten.
In Folgendem soll die Entwicklungsgeschichte des
intraarticularen Bandapparates des Hüft- und Kniegelenkes, ferner die Bildung
des Limbus cartilagineus der Pfanne und der Cartilagines falcatae der
Tibiacondylen ihre Erörterung finden. Das Untersuchungsmaterial war:
Kaninchen-Embryonen vom 12.-18. Tage, Mäuse- und Schweins-Embryonen von 1.3 und
1.5 Ctm. Länge entnommen. Ferner boten sich uns menschliche Früchte von
ungefähr 2.2 Ctm. Länge als ein willkommenes Materiale für unsere
Untersuchungen. Der Embryo wurde durch Dorso-Ventralschnitte zerlegt; bald völlig
horizontal bald mehr diagonal verlaufend, enthielten sie demnach grössere oder
geringere Kopf- und Pfannenabschnitte. Senkrechte Schnitte, welche durch Darm-
und Sitzbeinanlage durch Femur und Tibia gingen, wurden derart angelegt, dass
man die vollständige Reihenfolge derselben erlangte. – Sie wurden theils
ungefärbt, theils nach vorgängiger Carmin- oder Eosinfärbung, in Glycerin oder
Damarlack eingeschlossen und der Untersuchung unterzogen.
Vorerst wollen wir das Verhalten dieser
primitiven die einzelnen Skelettheile verbindenden Masse, wie sie sich uns am
Hüftgelenke präsentirt, berücksichtigen, und alsdann den eigenthümlichen
Wandlungen derselben folgen.
An Kaninchenembryonen vom 12.-15. Tage, sehen
wir das Hüftgelenk deutlich differenzirt, in einen der Syndesmose
vergleichbaren Zustande. Wir sehen den Raum zwischen der schwachen Concavität
der Pfanne und dem primären Kopfe von einem Gewebe ausgefüllt, welches sich
überall durch seine tiefe Carmintinction von der übrigen Skeletanlage (Fig. II
Z) unterscheidet. Bei starker Vergrösserung betrachtet sind es in der ersten
Zeit runde, schwach granulirte, dichtgedrängte Zellen, ohne
Intercellularsubstanz, analog denen der ersten Substanzanlage der Extremitäten.
Die Zahl der Zellenreihen dieser Zwischensubstanz ist gegen den unteren und
vorderen Abschnitt des Gelenkes, in der Nähe der Fossa acetabuli am
mächtigsten, die schmalste Zone fällt zwischen Kopf und hintere Pfannenwand
(Fig. I und II), was dem bei der Entwicklung der Extremitäten eingenommenen
Flexionswinkel entspricht. -- Daher ist auch der Zusammenhang der Zwischenzone
des Hüftgelenkes mit den nächsten die Substanzanlage der Extremität bildenden
Zellen, in der Gegend der hinteren Pfannenwand auf ein schmales Gebiet
beschränkt, während nach vorn und namentlich nach unten die niedrigen Wandungen
der flachen Pfanne breite Verbindungen zulassen.
Der continuirliche Uebergang dieser Zellen in
die primordialknorpeligen Gelenksanlagen einerseits, andererseits in die
perichondrale Bekleidung der knorpeligen Skelettheile, ist trotz der
frühzeitigen Höhergestaltung der letzteren zu dichtem fibrillärem Bindegewebe
leicht nachweisbar.
An den den Gelenksenden nahen Abschnitten des
Perichondriums sind an der innersten Schichte mehrere Lagen von Bildungszellen
erkennbar. Dies ist noch zu einer Zeit der Fall, wo die diaphysären Umhüllungen
sich durchaus als faseriges Bindegewebe präsentiren.
Das Acetabulum ist auffallend flach und besitzt
verschieden grosse Krümmungsradien. – Die schon in diesem Stadium sehr breite,
mächtig vorspringende hintere Pfannenwand (Fig. I H) gibt ihr die nöthige
Tiefe, um den convexen Schenkelkopf bergen zu können. – Der Pfannenboden wird
durch wohlcharakterisirtes Knorpelgewebe mit sowohl senkrecht als auch parallel
zur Krümmungsoberfläche gestellten Knorpelzellen gebildet. – Das Vorhandensein
der Knorpelfuge, welche einer Zusammensetzung des Hüftbeines aus den bekannten
drei Theilen entspricht, konnte von keinem der bisherigen Beobachter
festgestellt werden.
Bei einem von mir untersuchten menschlichen
Embryo von 2 Ctm. Länge (in Fig. II Kf) konnte das Vorhandensein der
Knorpelfuge unzweifelhaft constatirt werden. – Von den bei der Pfannenbildung
concurrirenden drei Knochen fiel nur die Darm-Sitzbeinanlage in die etwas
schiefe Schnittrichtung, man sieht die beiden getrennt durch die
zwischenliegenden Bildungszellen der Zwischenzone (Z in Fig. II).
Die grosse Zahl der untersuchten
Säugethierembryonen liess diesen Befund stets vermissen. – Aus dieser
vereinzelten Beobachtung einer Knorpelfuge am embryonalen menschlichen Becken,
erhalten wir die Anlage und Entwicklung betreffend, nur ungenügenden
Aufschluss. Dieser Befund lässt aber mit Sicherheit constatiren, dass es die
Elemente der Zwischenzone sind (Fig. II Z), welche sich an der Bildung der
Knorpelfuge betheiligen, während die innere perichondrale Bekleidung des
knorpeligen Darmbeines (Fig. II Pi) von der Bildung ausgeschlossen bleibt.
Besondere Erwähnung verdienen die an den Knäufen
des Tuber ischii und der Crista ilei (Fig. I B B) vorfindlichen, dichten
Anhäufungen von undifferenzirtem Bildungsgewebe und der allmälige Uebergang
desselben zu Knorpel- und Sehnengewebe. Die innere zu dieser Zeit der
Entwicklung schon als Perichondrium anzusprechende Bekleidungsschichte (Fig. I
Pi) des Darmbeines ist vom Knorpel schärfer abgegrenzt als die äussere.
Der convexe Femurkopf zeigt eine bedeutende
Abflachung (Fig. III) an der Stelle des Umbo und eine rinnenförmige Vertiefung
(Fig. IV R) im Verlaufe des Lig. teres. – Schenkelhals und Trochanteren (S Fig.
III und IV) sind in entsprechender Grösse vorhanden. In gleicher Weise, wie
oben erwähnt, findet sich an beiden Trochanteren und in der Fossa trochanterica
die Anhäufung undifferenzirten Bildungsgewebes.
Der primäre Kopf wird aus Knorpelelementen von
charakteristischer Anordnung gebildet. Es nehmen wie an anderen späteren
Röhrenknochen, so auch am Femur (Fig. IV F) von den Diaphysen her, die
Knorpelzellen an Grösse ab und die einzelnen Zellkörper und Kerne stellen sich
mit ihrem grösseren Durchmesser quer zur Längsachse der betreffenden
Skelettheile, – sowie man die späteren Epiphysengrenzen überschreitet. An der
Oberfläche der Gelenkskörper endlich sind ganz platte, spindelförmige
Zellformen, deren Verhalten zu den Zwischenzonen näher erörtert werden soll.
Der differente histologische Befund als Ausdruck
der fortschreitenden Höhergestaltung an den das embryonale Gelenk
constituirenden Gebilden ist sehr auffällig. – Zuerst ist es der continuirliche
Uebergang des an der Intercellularsubstanz armen, aus rundlichen und ovalen
Bildungszellen bestehenden Gewebes in die primär-knorpeligen Gelenksanlagen und
später dieselbe Continuität und Begrenzung durch charakteristische
Spindelzellenformen.
Die Zwischenzonen enthalten nämlich das
erforderliche Material an Bildungszellen für die Accessionen des primären
Gelenkskopfes und der Pfanne; auf Rechnung ihrer Elemente kommt es zur Bildung
des bleibenden Knorpelüberzuges der Gelenke. – Diese auch von Reyher und Henke
(1) gewürdigte Thatsache vollzieht sich nach einem doppelten, histologisch
unterscheidbaren Modus: einmal erscheint eine homogene, hyaline
Intercellularsubstanz und die Zellen erhalten allmälig die Form der
Knorpelzellen, wobei sich das Gewebe durch Pikrocarmin gelb färbt; ein
anderesmal sind es Accessionen platter, spindeliger Zellen von minimalstem
Protoplasmagehalt, welche in mehreren Reihen den sphärischen Gelenkskopf oder
die Pfanne bedecken. – Es gelang mir an einem Präparate, das einem 18 Tage
alten Kaninchen embryo entnommen war, in ähnlicher Weise wie es bei käsiger,
tuberculöser Ostitis des Schenkel- oder Humeruskopfes gelingt, den
Gelenksknorpel in toto abzuheben – die ganze accessorische Knorpelschichte
loszulösen. – Der primäre Kopf und Hals blieb hiebei mit dem Femurschaft, der
abgelöste Theil mit dem runden Schenkelband im Zusammenhange.
Die einschlägige Literatur gibt uns über die
Entwicklung der intraarticulären Bandapparate keine nach jeder Richtung
befriedigende Auskunft.
Die schätzenswerthen Arbeiten Welcker's (2)
neben denen Savory's (3), Humphry's (4) und Huxley's (5) geben uns in
vergleichend anatomischer Beziehung wichtige Aufschlüsse. – Wir erfahren aus
ihnen das Fehlen des Lig. teres bei Pithecus (Orang-Outang), während es bei
anderen anthropomorphen Affen, dem Chimpanse in gleicher Weise wie beim
Menschen vorhanden ist; es fehlt ferner bei dem Elephanten, Nilpferde und
Nashorne. Als ein Beispiel der bleibend sessilen Form des runden Schenkelbandes
stellt Welcker den Seehund hin, welcher das mehrerwähnte Band in Form einer von
der Kapselwand sich abhebenden, vom Pfannenrande zum Rande des Schenkelkopfes
tretenden Falte, besitzt. Savory hingegen erklärt es für fehlend. – Der
geburtsreife Tapir americanus besitzt ein Lig. teres, das durch eine
mesenteriumartige Falte der Synovial haut an die Kapsel angeheftet ist, jedoch
eine feine Perforation in dieser Synovialhaut zeigt, welche Welcker für den ersten
Schritt des Freiwerdens ansieht. – ,,Man trifft denn auch beim erwachsenen
Thiere ein völlig freies, längs seines ganzen Verlaufes umgreifbares - in
dieser Beziehung dem Menschen völlig gleiches – Ligamentum teres“.
1) 1. c.
2) ,,Nachweis eines Lig. teres artic. hum.,
sowie eines Lig. teres sessile femoris. “ Zeitschr. f. Anat. u. Entw. II. S.
98-107. ,,Zur Anat. d. Lig. teres femoris.“ Jahresb. von Schwalbe und Hoffmann.
S. 231-235. „Die Einwand. d. Bicepssehne in das Schultergel., nebst Notiz.
über d. Lig. interarticul. hum. u. Lig. teres fem.“ Arch. f. Anat. u. Physiol.
Anat. Abth. I. Heft 1878.
3) ,,The use of the lig. Teres of the
Hip-joint“. Cambridge Philos.
Soc. – The Lancet 23. Mai.
4) „On the Human Skeleton, including the Joints“.
Virch. Jahresb. IX. Jahrg. I. Bd. 1874.
5) „Handb. d. Anat. d. Wirbelth.“ Deutsch von Ratzel 1873.
Gestützt auf das Vorkommen eines Ligam. teres
sessile femoris, beim Tapir, Seehund und auf einen analogen Befund bei einem
menschlichen, mehrfach missbildeten (Luxatio congenita) 7monatlichen Fötus, ist
Welcker geneigt diese Beobachtungen auf die Entwicklung des runden
Schenkelbandes beim Menschen zu übertragen. Er meint, dass das Lig. teres
femoris durch Einwanderung gewisser extracapsulärer Bandfasern in das Innere
der Hüftgelenkskapsel entsteht, oder wie er es jüngst bezeichnet: „als ein
inneres Sichloslösen eines der Wandung der Höhle selbst angehörigen Theiles.“
Er fügt aber noch hinzu „dass die Bildung des Lig. teres beim Menschen nicht
bloss auf jenem bei Thieren beobachteten pilasterförmigen Einrücken beruht,
sondern dass der femorale Abschnitt des Pilasters sich von der Fläche des
Kopfes - auf welchem derselbe ursprünglich festverwachsen aufliegt loszuheben
hat. Im Gefolge dieser Loshebung dürfte dann auch die Fovea sich bilden.“
Es zeigt Fig. I das Hüftgelenk eines 1-5 Ctm.
langen Kaninchenembryo. – Wir sehen, wie in dem breitesten dem Schenkelkopf
näher gelegenen Abschnitt der Zwischenzone die Höhergestaltung der hier
vorfindlichen embryonalen Rundzellen rasch platzzugreifen beginnt; die Zellen
erhalten nach einer oder zwei Richtungen sich verlängernd eine längliche
spindelförmige Gestalt, während gleichzeitig das Auftreten einer
Intercellularsubstanz bemerklich ist. Die charakteristische Anordnung der Zellenzüge,
die der Convexität des Kopfes folgende Verlaufsrichtung von vorne unten nach
hinten und die nach dieser Richtung erfolgende Breiten abnahme, lässt es kaum
bezweifeln, dass wir das Band im ersten Entwicklungsstadium vor uns haben. – Bei
starker Vergrösserung sieht man an demselben Präparat, dass der Schenkelkopf zu
dieser Zeit der histologischen Sonderung noch eine Bedeckung von mehreren
Reihen der ursprünglichen Bildungszellen besitzt, als Ausdruck der Grenze der
Gewebsumwandlung. – Indem nun diese für die Accessionen des primären Kopfes
eintretenden Bildungszellen proliferiren und ihre Umwandlung zu
lanzettförmigen, platten Zellen etc. beginnen, wird der Uebergang dieser in
jene der Bandelemente ein so allgemeiner, dass trotz des Auftretens fibrillarer
Grundsubstanz bei letzteren eine Unterscheidung kaum möglich wird.
Dieses Spindelzellengewebe vollendet seinen
typischen Entwicklungsgang, indem es noch anfangs ein zellenreiches, faseriges
Bindegewebe (Fig. IV Lt) repräsentirt, das neben den gewöhnlichen
Bindegewebskörperchen selbst noch zahlreiche, eingestreute Knorpelzellen
besitzt, bis es endlich den Charakter des Sehnengewebes erlangt, wie es zur
Zeit der Geburt angetroffen wird.
Die femorale Insertion des runden Schenkelbandes
in Fig. III Lt, das Hüftgelenk eines menschlichen Embryo von 2-2 Ctm. Länge
darstellend, zeigt die bedeutende Abflachung des Kopfes in der Gegend des Umbo;
der Schnitt legt die Fovea capitis (Fig. III F) in ihrer ganzen Tiefe bloss und
zeigt ihre Ausfüllung durch die Bandelemente. Bei starker Vergrösserung sieht
man hier sowohl wie auch bei Kaninchen embryonen (16.-20. Tag), welche diesem
Entwicklungsstadium entsprechen, dass faseriges Bindegewebe, ferner deutlich
differenzirte Knorpelzellen und Uebergangsgebilde von Bildungszellen zu
Knorpelzellen, ohne genau zu ermittelnde Grenzen in einander übergehen.
Wir kämen in Gefahr uns einer argen Täuschung
hinzugeben, wenn ein den centralen Theil des runden Bandes blosslegender
Schnitt von Kaninchenembryonen des vorerwähnten Alters uns vorläge. Eine den
ganzen Verlauf des Bandes, bis in die Fovea capitis hinein einnehmende von
dichten Faserzügen begrenzte Gewebszone von verschiedener Breite könnte uns
bestimmen, das Band vorwiegend aus den hier vorfindlichen Elementen
zusammengesetzt zu halten. sind zumeist rundliche oder ovale Zellen kleinster
Bildung von enorm dichter Anordnung; die Agglomeration und die dunkle Färbung
lässt das Vorhandensein sowie die Beschaffenheit der Intercellularsubstanz
nicht verkennen.
Aus diesen Zellen wird wohl später das zarte,
gallertige und perivasculare Bindegewebe der centralen Partie des runden
Bandes. - Paletta (1) beschreibt das Band beim 7-8monatlichen Fötus und sagt:
Die zwischen den drei Bündeln befindliche kleine Höhle ist
gegen die Pfanne und das Querband weiter, verengt sich aber gegen den Kopf hin und ist also kegelförmig. „Die erwähnte Höhle wird deutlich, wenn man die äusseren Hüftbeinmuskeln entblösst, das Zellgewebe im Umfange des Hüftbeinloches trennt und nun eine dünne Sonde bis zum Oberschenkelkopf einschiebt”.
1) „Exercitiones pathologicae” Mediol. 1820 pag. 69. Meckel's Arch. 6. Bd. pag. 341.
Das Band besitzt auch im Embryo eine breite
Insertion an der Pfanne und ein verschmälertes Femurende. – Einen Zusammenhang
mit den Längsfasern der Kapsel im Sinne eines wandständigen Ligamentes konnte
ich niemals, hingegen den Uebergang einzelner Faserzüge in die den Schenkelhals
bekleidende Umschlagstelle der Hüftgelenkskapsel an entsprechenden Schnitten
leicht constatiren. - Die im Inneren des Hüftgelenkes vorhandenen zum Gebiete
der Art. und Ven. obturatoria gehörenden Gefässe sind bei manchen Embryonen,
bei weissen Mäusen und dem Meerschweinchen auffallend frühzeitig zu sehen und
liefern durch ihre natürliche Füllung schöne Bilder. Bei 16-18 Tage alten
Kaninchen embryonen liegen in der Nähe der Fovea capitis sowohl oberflächlich
als auch in der Substanz des Bandes eingelagert zahlreiche zierliche
Gefässschlingen, welche theils in den knorpeligen Gelenkskopf eintreten, theils
auf der Oberfläche desselben sich mit langgestreckten Schlingen verästigen. – Vereinzelte
Gefässe treten auch im Verlaufe des Bandes zu Tage. – Der frühzeitig die
Substanzanlage der unteren Extremität durchziehende Nervenstamm gab keine an
und in das Gelenk verfolgbaren Zweige ab.
Sobald die Accessionen von Bildungszellen ihre
Umwandlung in die abgeplatteten Knorpelzellen des Femurgelenksknorpels
vollendet haben, liegt für die Loslösung des Bandes kein Hinderniss mehr vor.
Dieses bei der Anlage und Entwicklung des Lig.
teres soeben beschriebene Verhalten der Zwischenzone lässt sich mit
Modificationen von untergeordneter Bedeutung, welche die Oertlichkeit und die
paarige Anlage erfordern, auch auf die Lig. cruciata des Kniegelenkes
übertragen.
Die am Menschen zu beobachtenden Varianten, das
fehlende und das sessile runde Schenkelband, sind wohl Beispiele von vererbter
Thierähnlichkeit und haben mit dem typischen Entwicklungsmodus nichts gemein;
zum Theil stehen sie in naher Beziehung mit der Bildung der Synovialmembran.
Ich unterliess es bisher jener mit den
Knorpelelementen des Pfannenrandes und der perichondralen Bekleidungsschicht
des Darmbeins in Continuität stehenden, nach der Oberfläche der Darmbeinanlage
und der Pfannenhöhle sich fortsetzenden Anhäufung von Bildungszellen Erwähnung
zu thun, aus welchen das Labrum cartilagineum (Fig. III und IV L) der Pfanne
hervorgeht. - Die etwas hellere Carminfärbung, die concentrische Anordnung der
zerstreuten oder in Gruppen beisammenliegenden, durch reichliches
Dazwischentreten von Intercellularsubstanz getrennten Zellen, die alsbald
fibrilläre Umwandlung der ersteren, sind die histologischen Merkmale dieses
Gewebes. Hierzu kommt noch der charakteristische Zusammenhang mit den senkrecht
verlaufenden Fibrillenzügen der primären Kapselwand. Im Limbus menschlicher
Embryonen bis zu 2 Monaten und Kaninchenembryonen bis zum 18.-20. Tag sind
weder Uebergangsgebilde zu Knorpelzellen, geschweige denn ausgebildete
Knorpelelemente auffindbar.
Bevor ich den Beweis für den secundären,
capsulären Ursprung des Labrum cartilagineum der Pfanne antrete, will ich die
Beschreibung der Entwicklung des Zwischengelenksknorpels der Tibia
vorausschicken, weil diese unter viel einfacheren und für die Beobachtung
günstigeren Verhältnissen stattfindet.
In Luschka's Monographie über „Die Halbgelenke
etc." findet sich folgender Passus: Beim Kniegelenk schienen mir die
Cartilagines falcatae als eine secundäre, von der Kapselmembran ausgehende
Formation aufzutreten. Henke und Reyher sagen ausdrücklich bei Beschreibung des
Kniegelenkes 6-8wöchentlicher menschlicher Früchte die Menisken sind noch nicht
angelegt, die Patella wohl.”
In Fig. V ist ein dem Kniegelenke eines 18 Tage
alten Kaninchenembryo entnommener Schnitt abgebildet. – Das durch die
Flexionsstellung bedingte Abstehen der embryonalen Gelenkenden von einander
(die Stellung ist etwa die eines nach hinten subluxirten Gelenkes) erleichtert
an diesem Orte die Untersuchung erheblich. – Die ungleich entwickelten und
gerundeten Condylenknäufe des Oberschenkels (Fig. V F) fassen eine tiefe
Incisura intercondyloidea (Fig. V J) zwischen sich; die Anlage der Tibiaknorren
(Fig. V T) ist auffallend breit und lässt die Eminentia intercondyloidea (Fig.
V E) stark hervortreten. Die sich umschlingenden Kreuzbänder (Fig. V Lc)
treffen wir in weit vorgeschrittener Entwicklung. – Die embryonalen
Gelenksenden bedeckt ein durch Carmin tiefroth gefärbter, aus mehreren
Schichten eines Spindelzellengewebes bestehender Saum (Fig. V S). – Die
perichondralen Bekleidungen des Femur und der Tibia (K K) gehen in
continuirlichem Zuge über das Gelenk hinweg; von der Innenwand dieses wohl
schon als Kapsel anzusprechenden Gewebes, schiebt sich jederseits ein im
Durchschnitte dreieckiges, pyramidales Gebilde (Fig. V Zw. Zw,.) in das
Kniegelenk, die capsuläre Anlage der Cartilagines falcatae, ein. Die obere, den
Femurcondylen zugewendete Seite derselben ist concav, die untere tibiale flach
und eben. – Der Lage nach näher den Tibiacondylen ohne ihnen jedoch
aufzuliegen, ragen sie sehr verschmälert weit hinein in das Innere des
Gelenkes, ohne sichtbare intercondyläre Insertion. – Die histologische
Zusammensetzung aus kleinen, rundlichen oder ovalen stark lichtbrechenden
Zellen und Kernen, welche in überwiegender und deutlich fibrillärer
Grundsubstanz zerstreut oder gruppirt liegen, ferner der innige Zusammenhang
mit dem noch zellenreichen, aus dichten, derben, senkrecht verlaufenden
Fibrillenzügen bestehenden Kapselgewebe, sind die charakteristischen Merkmale
des Zwischengelenksknorpels dieser Zeitperiode.
Die gleichartige Entwicklung bezeugenden
gemeinschaftlichen Eigenschaften beider Gebilde des – Labrum und der
Cartilagines falcatae sind enthalten: in der vollkommen gleichen histologischen
Zusammensetzung des Gewebes und dem gleichen Verhalten gegenüber dem primären
Kapselgewebe. – Nur bezüglich der Localität macht sich eine Modification
geltend, durch welche das einfache Bild der capsulären Anlage wie es uns am
Meniscus des Kniegelenkes entgegentritt, am Limbus alterirt wird. Der künftige
Faserknorpel der Pfanne ist nämlich gleich bei der Anlage, entsprechend seiner
das Acetabulum completirenden Bestimmung dem Pfannenrande aufgestülpt; seine
Zellen lagern sich concentrisch und übergehen ohne deutliche Abgrenzung in die
Knorpelelemente des Pfannenrandes.
Bei 18-20 Tage alten Kaninchenembryonen ragt die
grosse Synovialfalte, das Lig. mucosum des Kniegelenkes in Gestalt einer
kuppelartigen Vorwölbung mit verbreiterter Basis, weit in des Gelenksinnere
hinein. Es besteht aus rundlichen oder ovalen kernhaltigen Zellen mit homogener
Intercellularsubstanz und wird von zahlreichen Capillaren und selbst grösseren
Gefässen durchzogen.
Wir haben die Leistungen des Gewebes der
Zwischenzo ne am embryonalen Hüft- und Kniegelenk mit Aufmerksamkeit verfolgt
und konnten im Gefolge der beobachteten Wandlungen derselben den typischen
Vorgang der Spaltbildung – den Uebergang aus dem mit der Syndesmose
vergleichbaren Zustand in einen der Amphiarthrose entsprechenden, allemal
constatiren. – In die Zeit der Diarthrosenbildung, der Entwicklung einer
gefäss- und nervenreichen, zottentragenden Synovialmembran erstreckten sich
unsere Untersuchungen nicht.
Im Anschluss an Luschka weist auch Hueter (1)
den Zwischenzonen eine vorwiegend passive Rolle zu, indem beide beim Vorgang
der Gelenksbildung einen von der Mitte ausgehenden allmälig gegen die
Peripherie fortschreitenden Verflüssigungsprocess, welcher sowohl die Zellen
als auch die Intercellularsubstanz betrifft, beschrieben. – Es ist bei Luschka
der Schwund, die Einschmelzung dieser Masse noch während des fötalen Lebens ein
gesetzmässiger Typus für die Entwicklung von Hohlgelenken, doch traf er
mehrmals längere Zeit nach der Geburt an diesen Gelenken auf dem Knorpel noch
einen Rest jener ursprünglichen Masse; bei anderen Gelenken trägt sie hinwieder
den Charakter der Solidität in sich und behält diesen während des ganzen
Lebens; z. B. bei den Synarthrosen.
Wenn wir uns nun die Frage über die Bestimmung
und die Art der Verwendung der Zwischenzonen bei der Entwicklung des Hüft- und
Kniegelenkes vorlegen, so lautet die Antwort:
„Die Zwischenzonen dieser Gelenke enthalten das
Bildungsmaterial: erstens für die Accessionen zur Configuration der primăren
Gelenksenden, zweitens für die Bildung des bleibenden Knorpelüberzuges der
Gelenke und drittens für den hier vorfindlichen intraarticulären Bandapparat. -
Der Limbus cartilagineus der Pfanne, die Cartilagines falcatae des Kniegelenkes
sind secundäre, capsuläre Anlagen.”
1) „Klinik der Gelenkskrankheiten” etc. Leipzig 1870.
Zur Erklärung der Abbildungen.
 |
| Fig. I. Hüftgelenk eines Kaninchen embryo, 1.5 Ctm. lang. Lt = Anlage des Lig. teres; Fig. II. Hüftgelenk eines menschlichen Embryo 2 Ctm. lang. |
External links
Schuster H. Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenks. Mittheilungen aus dem embryol. Institut zu Wien. Bd. I. Wien: W. Braumüller, 1880; 199-212. [books.google]
Authors & Affiliations
H. Schuster
Embryological Institute of the Imperial-Royal University in Vienna
Keywords
ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, ligament of head of femur, anatomy, animals, embryology, development
NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7
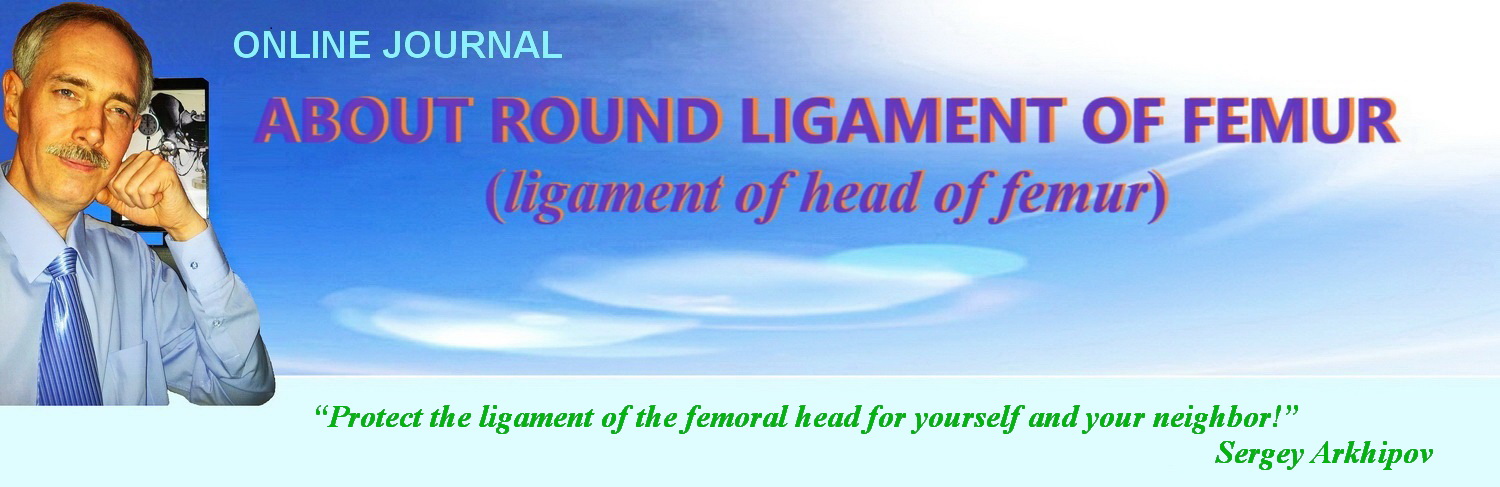


Comments
Post a Comment