Content
Article: Láng A, Bálint J. Beiträge zur Anatomie des Ligamentum teres
femoris. (1953). The authors discuss the arterial vessels of the ligamentum
capitis femoris (LCF) and the blood supply to the femoral head. The text in Russian
is available at the following link: 1953LangA_BalintJ.
BEITRÄGE ZUR ANATOMIE DES LIGAMENTUM TERES FEMORIS
Adolf Láng und József Bálint
(Eingegangen am 27. Aug. 1952.)
Einleitung
Nach Luxationen des Hüftgelenks muss im Femurkopf und -hals mit aseptischer
Nekrose gerechnet werden die mit schweren Symptomen ein hergeht. Die Röntgenuntersuchung
zeigt in solchen Fällen an Osteochondritisdissecans erinnernde Veränderungen.
Roth (1940) beob ach tete nach 41 traumatischen Luxationen nur in 16% der
Fälle vollständige Restitutio n (Mitteilung von Ratkóczy).
Ratkóczy (1949) hat nach traumatischen Luxationen des Hüftgelenke sehr
schwere Veränderungen festg estellt. Láng berich tete auf Grund eigener Beobachtung
über 9 K opfnekrosen und lenkte die Aufm erksam keit der Chirurgen-Fachgruppe auf
dieses schwere Krankheitsbild (1950).
Übersicht des Schrifttums
Nach den Untersuchungen von Láng (1951) ist das Ligamentum teres femoris
der Leiter von Blutgefässen, die die Blutversorgung des Kopfes sichern. Nach
früheren Literaturangaben fehlt das Ligamentum teres in einem Drittel der
Fälle. Hoffa fand dass es in 200 Fällen 54mal fehlte (1905). Die neueren
Untersuchungen bestätigen diese Angaben. Aus der Diskussion mit Gara im Orvosi
Hetilap (1952) ging hervor, dass nach Tucker (zit. Gara) der Femurkopf in 70% der
Fälle von der A. capitis fem. ernährt wird. Chandler und Kreuscher (1932) sowie
Nordenson sind von diese Zahlen nicht ganz überzeugt.
Diese Autoren schreiben: »in nearly all the cases examined some vessels
w ere present in the ligament and sufficiently large to be of nutritional importance.
In some cases in the higher age-classes the vessels had sometimes undergone
sclerotic processes as a part of general arteriosclerosis« (Zitat aus der
Arbeit von Nils Carlquist : Comparison of the results from non-operative treatment
and from osteosynthesis etc.« Acta Chir. Scand. XCV. Suppl. 127. S. 14.)
Der Femurkopf sowie auch der Femurhals ist gegenüber Ernährungsstörungen
besonders empfindlich. Schmorl (1924.) wies nach, dass zu ihrer Nekrose schon
eine Knickung der Blutgefässe genügt. Bei der Hüftgelenksluxation zerreist das
Ligam entum teres infolge des Traumas. Durch den Riss wird auch die A. capitis
fern, verletzt.
Bekanntlich entsteht nicht nach jeder Hüftgelenksluxation eine
Spätnekrose des Kopfes. Es scheint, dass in diesen Fällen kein Ligamentum teres
vorhanden war, und die Blutversorgung des Kopfes entsprechend der Anomalie
nicht aus der A. capitis fem., sondern aus einem anderen abnorm al entwickelten
Gefässsystem gesichert wurde.
Die französische Anatomie legt dem Lig. teres keine besondere B edeutung
bei. Im Lehrbuch von Jacob — Testut : Traité d’Anatomie topographique (1922)
II. Band S. 45. ist über der Lig. teres folgende zu lesen : »C’est-à-dire qu’il
ne joue aucun des rôles m ultiples que les divers auteurs lui ont tour à tour
attribués«. Neuerdings beschäftigen sich allerdings Muralre (1945) (zit. von G
ranel) und Granel (1947) eingehend m it dieser Frage. Letzterer wies an seinen
Injektionspraeparaten nach, dass die in die A. hypogastrica eingespritzte Masse
den Knorpel intakt lässt und tief ins Kopfknochenmark eindringt. Dies bestätigt
den Untersuchungsbefund von Muratre, wonach sich im Pulvinar Jugendlicher, im
Lig. teres an der Peripherie der A. capitis fem., in der Linie der Epiphyse,
aus Arteriolen und Venülen bestehende Glomeruli befinden , während diese bei Neugeborenen
und im ersten Lebensjahr fehlen. Der spezifische Gefäss apparat des
Hüftgelenks, die arteriovenösen A nastom osen und Gefässpolster, sind wichtige Faktorenim
Blutkreislauf des Femurkopf-Knochenm arksystems und spielen eine wichtige Rolle
in der Versorgung dieses Gelenksteils.
Unabhängig von diesen U ntersuchungen gelang es Láng in seiner 1951.
veröffentlichten Arbeit, den Übergang der Arterienendäste in Glomeruli in der
Epiphysenlinie nicht nur jugendlicher, sondern auch älterer Personen
nachzuweisen (Abb. 21) und die verschiedenen Typen der Glomeruli sowie im Verlauf
der Arterien den Apparat darzustellen, der den Blutkreislauf des Knochenm arks
reguliert.
Neuere anatomische Untersuchungen am proxim alem Femurende (Láng und
Nagy 1952) bekräftigen die früheren diesbezüglichen Angaben von Láng (1915) und
beleuchten — auch bei erfolgreicher Heilung — das spätere Schicksal der Femurhalsfrakturen.
Aus diesen Untersuchungen ging hervor, dass die Blutversorgung des
Schenkelhalses und seines Knochenmarkes dem Leben des Knochens entsprechend
ist. Doch entspricht diese Blutversorgung des Schenkelhalses nur den normalen
Lebensbedingungen. Die Heilung von Knochenfrakturen aber beansnrucht gesteigerte
Lebensaktivität, die reichlichere Blutversorgung erfordert. Diese scheint im
Femurhals nicht immer vorhanden zu sein.
Die Skizze von Christopher (1940) über die B lutversorgung des
proximalen Femurabschnitts erinnert lebhaft an das Röntgenbild des
Injektionspräparates das Láng im Jahre 1915 herstellte und veröffentlichte
(Orvosi Hetilap und D eutsche Zeitschrift für Chir. 1915).
Die in der während der Revision dieser Arbeit erschienenen Studie von F.
D. Nikolajew veröffentlichten R öntgenaufnahm en von Injektionspräparaten
lassen in der Blutversorgung des Schenkelhalses sehr ähnliche Verhältnisse
erkennen.
Die Gefahr der Pseudarthrosebildung nach den m edialen F rakturen des
Schenkelhalses entsteht nach den Untersuchungen von Láng und Nagy ebenfalls
deshalb, weil an dieser Stelle nur die für normale Inanspruchnahme benötigte Blutversorgung
vorhanden ist und die Fraktur die Anastomosen zwischen dem Femurkopf und der
Fossa trochaterica unterbricht.
Die nach Schenkelhalsfrakturen folgenden schweren Ernährungsstörungen
der Knochen treten auch im Kinderalter auf ; so dass die Osteosynthese in
diesen Fällen zu besonders ungünstig en Ergebnissen führt (Salem 1949).
Eigene Untersuchungen
Zweck
der vorliegenden Untersuchungen ist die Erweiterung der Anatomie des Lig. teres
fem., um über die Entwicklung des Krankheitsbildes weitere Kenntnisse zu
gewinnen, und um die durch die Verletzung der A. capitis fem., verursachten
später auftretenden schweren klinischen Symptomen und Knochendestruktionen
eingehend erklären zu können.
Die
Untersuchungen wurden an Embryonen verschiedenen Alters und reifen Embryonen,
ferner an Leichnamen jugendlicher und älterer Personen durchgeführt. Das Ziel
der Untersuchungen war, die ontogenetische Erklärung für die spezifische
Blutversorgung des Femurkopfes und -halses zu finden. Unser ferneres Interesse
galt dem oberen Ende des Schenkelbeins älterer Personen, da wir feststellen
wollten, was die Ursache der Frakturen ist, die an diesem Knochenabschnitt auch
ohne Unfall auftreten. Bei Kindern haben wir die Untersuchung des Lig. teres
unterlassen, da die Blutversorgung des proximalen Femurendes allgemein bekannt
ist, ja aus deren Untersuchung falsche Schlussfolgerungen auf die im späteren
Alter herrschenden Verhältnisse gezogen wurden.
Untersuchungsmethoden
Die Blutgefässe des Lig. teres von Embryonen und Neugeborenen füllten
wir vom linken Herzen her, die der Erwachsenen über die A. iliaca com. mit
verdünnter Tusche. Einen Teil des Untersuchungsm aterials prüften wir durch
Methylenblaufärbung, die Herstellung durchsichtiger Präparate geschah nach
Spalteholtz, den andern Teil untersuchten wir nach Form alinfixation und Zelloidin-Paraffin
Einbettung mit Hämatoxylin-Eosin und Van Gieson-Färbung, die Nerven w urden
nach der Methode von Kiss—Gellert—Bacsich sichtbar gemacht. Die Untersuchungen
wurden an 32 Embryonen verschiedenen Alters sowie 4 siebzehn-einundzwanzigjährigen
und 7 fünfundsechzig-zweiundsiebzigjährigen Leichen ausgeführt.
Untersuchungsergebnisse
Embryologische Untersuchungen
Die
Gefässe des Lig. teres des jüngsten untersuchten 4½-monatigen Embryos
vereinigen sich in der Fovea capitis büschelartig, die Blutgefässversorgung des
Schenkelbeinkopfes ist wesentlich geringer als die der Fossa trochanterica,
woraus in den Femurkopf auch eine Schlagader eindringt. Aus der Linea
intertrochanterica ant. verlaufen – parallel mit der Achse des Schenkelhalses –
einige auch den Femurkopf erreichende, ja auch in diesen eindringende
kräftigere Arterienstämme, aus denen sich ein sehr feines retikuläres
Arteriennetz bildet. Dieses Arteriennetz umspannt fast vollständig den beim
Embryo auffallend kurzen Schenkelhals. Im weiteren Verlauf der Epiphysenlinie
läuft fast linienartig eine Blutgefässform, die feiner ist als die
vorhergehende und aus der noch feinere Äste nach oben und unten verlaufen.
Diese Blutgefässform ist an mehreren Stellen ausgebuchtet, und von diesen
Ausbuchtungen gehen zahllose Kapillaren in Sternform in den Schenkelhals, in
den Kopf dagegen kaum ein oder zwei. Aus den hier beschriebenen Ausbuchtungen,
d. h. bulbüsartigen Bildungen, entwickeln sich die von Granel und Läng
unabhängig voneinander nachgewiesenen, schon beim Neugeborenen gut erkennbaren
knäuelartigen Blutgefässe.
In diesem Alter ist der Schenkelkopf nur am proximalen und distalen Ende
blutgefässreich. Der Kopf selbst stellt im Spalteholtz-Präparat ein glasartig
durchsichtiges, blutgefässloses Gebilde dar. In den proximalen Teil des Kopfes
sendet die A. acetabuli nach ihrem kurzen Verlauf bereits eine wellenförmige A.
capitis femoris, die sich nach Durchdringung der Fovea sogleich zu einem nicht
allzu reichen Netz zerteilt. Im unteren, äusseren, nach dem Trochanter major zu
befindlichen Segment des Kopfes ist ebenfalls die aus der Fossa trochanterica
stammende Gefässversorgung zu erkennen. Diese und die Kopfgefässe entwickeln
sich aus besonderen Anlagen; die Gefässe dieser Anlagen anastomosieren
miteinander nicht.
Die Gefässe im Lig. teres
des 5.5 monatischen Embryos verdichten sich, bilden ein Geflecht und lösen sich
nach Durchdringung der Fovea nicht weit vom Lig. teres zu einem
schlingenbildenden, dichten Netz auf (Abb. 1). Die Fossa trochanterica besitzt
reiche Gefässversorgung; von hier dringt je ein grösseres Gefäss rechtwinklig
in geradem Verlauf in den Kopf ein, doch anastomosieren, wie bereits erwähnt,
diese beiden Gefässbezirke miteinander nicht. Zwei Wochen später erreichen die
Gefässe der Fossa trochanterica auch die grössten Erhöhungen des Kopfes, ohne dass
indessen zwischen den beiden Gefässbereichen eine Verbindung bestünde (Abb. 2).
Die Äste der beiden Gefässbereiche der ausgetriebenen Frucht nähern sich
einander ohne entschiedene Anzeichen der Anastomose. Die von der Fossa
trochanterica herkommenden dickeren Äste gelangen zwar bis zur Eintrittsstelle
des Lig. teres und erreichen dessen Gefässe (Abb. 3), doch ist es nicht
möglich, die Verbindung der beiden Gefässbereiche mit sich erneut nachzuweisen.
Die Gefässe des Lig. teres ordnen sich, auch bilden sich zwei gut entwickelte
A. capitis; ein Teil ihrer Äste wendet sich durch Schlingenbildung zurück,
während der andere Teil schon in die tiefere Schicht eindringt und in distaler
Richtung verläuft. In der reifen Frucht teilt sich die A. acetabuli, von der die
A. capitis stammt, auch hier in zwei Äste, von denen der erste gerade verläuft
und in das Pulvinar gelangt. In diesem Alter beginnt der Verlauf der doppelten
A. capitis fern, dem der Erwachsenen ähnlich zu werden und läuft der
Inspirationsnahme entsprechend in gewundener Form (Abb. 4).
Die in der Epiphysenlinie der Erwachsenen unserseits beschriebenen
schlingenartigen Gefässe fanden wir in Spuren auch beim 4%-monatischen Embryo.
In diesem Alter befinden sich in dem den Schenkelkopf distal begrenzenden
Gebiet quer verlaufende, sehr feine, hier und da bulbusartig ausgebuchtete
Gefässe; diese Ausbuchtungen sind die ersten Spuren der späteren
schlingenartigen Blutgefässe, die beim neunmonatigen Embryo bereits
ausgesprochen deutlich und entwickelt sind.
In
Zusammenfassung der embryologischen Untersuchungen lässt sich folgendes sagen:
- Die Blutversorgung von
Schenkelkopf und -hals stammt aus zwei verschiedenen Anlagen und zwei
verschiedenen Quellen, der A. hypogastrica und der A. femoralis.
- Die Verbindung dieser
beiden Anlagen miteinander ist im embryonalen Zustand noch nicht
vorhanden. Beim Neugeborenen gelangen die Gefässe der Fossa trochanterica
hinauf bis zur Eintrittsstelle der A. capitis femoris.
- Spuren der in der
späteren Epiphysenlinie gelagerten, wahrscheinlich aus arteriovenösen
Anastomosen bestehenden (Granel) Glomus finden sich bereits beim 4 ½ Monate
alten Embryo und sind bei der reifen Frucht schon entwickelt.
- Der der Inspirationsnahme
entsprechende gewundene Verlauf der A. capitis femoris konnte bereits beim
Neugeborenen festgestellt werden.
- Bei 32 untersuchten Embryonen konnten wir das Lig. teres und die darin laufenden Gefässe erkennen.
Die
Blutgefässe des Lig. teres der Erwachsenen unterscheiden sich wesentlich von
denen der Kinder und Jugendlichen. Dieser Unterschied wird mit zunehmendem
Alter immer auffallender. Während wir im Ligament von 21-jährigen Personen
arteriovenöse Anastomosen (Abb. 5) und auf den Serienschnitten der Gefässe
Blutgefässpolster (Abb. 6) fanden, konnten im fortgeschrittenen Alter diese Bildungen
nicht angetroffen werden, und im hohen Alter nur die Obliteration der grösseren
Arterien festgestellt werden.
In den
Gefässpolstern lässt sich, wie auch aus der erwähnten Abbildung hervorgeht, die
gleiche Struktur erkennen wie in anderen Blutgefässpolstern. Der Gefässpolster
auf der Abbildung stammt aus der Adventitia der Vene und ist mit Endothel
bedeckt.
Der je nach
dem Alter verschiedene Gefässapparat des Lig. teres passt sich der Befriedigung
des für das Knochenmark funktionell erforderlichen Blutbedarfs an. Das über
einen grösseren Blutbedarf verfügende junge Knochenmark benötigt zur Abwicklung
der Durchströmung des produzierten Blutes einen anderen Apparat als das nicht
mehr produzierende alte Knochenmark. Im höheren Alter obliterieren die grösseren
Arterienzweige. Zur Sicherung des Lebens von Knochenmark und Knochen bildet
sich jedoch um die obliterierten Gefässe ein neues Blutgefässgeflecht, dessen
Äste jedoch in ihrer Gesamtheit nur noch geringeren Ansprüchen genügen. In den
obliterierten und sich obliterierenden grösseren Arterienzweigen des Lig. teres
älterer Personen fanden wir ein bis zur Ubefüllung vollgestopftes, aus
zahlreichen feinen Ästen bestehendes Geflecht (Abb. 7). Das Blutgefässgeflecht
hatte sich in der Umgebung des verschlossenen Arterienstammes gebildet, doch
sahen wir solche auch in grösserer Entfernung vom verschlossenen Gefäss, jedoch
nicht so weit entfernt, dass ein anderer Gefässplexus vorausgesetzt werden
konnte.
Der Ersatz
der obliterierten Gefässe entspricht dem Bedürfnis. Eine ausreichende Blutmenge
findet sich auch in den Zotten des Lig. teres, in denen die mit Blut gefüllten
Gefässe durch Schlingenbildung zurückgelangen. In diesen Schlingen lassen sich
weder der afferente noch der efferente Zweig voneinander unterscheiden. Auf den
nach Spalteholtz durchsichtigen und blattartig ausgebreiteten Präparaten (Abb.
8) ist auch der Verlauf der feinen Endäste der Inspirationsnahme entsprechend
gewunden.
Von den Zotten des Lig.
teres ist ein Teil pilzartig, flach, ein anderer Teil jedoch ziemlich lang und
endet spitz. Im Mittelteil der letzteren befinden sich Gefässe, die bei den
flachen Zotten an deren freiem Ende anzutreffen sind. Die Zotten sind von einer
Serosa bedeckt, während ihr Inneres aus dickem kollagenem Bindegewebe besteht.
Zum
Studium der Nerven des Lig. teres fem. benutzten wir die Methode
Kiss-Gellêrt-Bacsich und konnten feststellen, dass die feinen Gefässe in der
Länge von feinen, gleichfalls wellig verlaufenden Nerven begleitet sind, die
sich baumastartig in dünnere Zweige teilen und in der Gefässwand verschwinden
(Abb. 9). Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Nerven die Ernährung der
Knochen und die Funktion des Knochenmarks regulieren.
Die
Untersuchung des Lig. teres fem. der Erwachsenen zusammenfassend, können wir
feststellen, dass ausser den bereits besprochenen Glomi und Gefässapparaten:
1. Arteriovenöse Anastomosen und
Gefässpolster die Blutzirkulation des Knochenmarks regeln.
2. Da bei älteren Personen der
Blutbedarf des Knochenmarks geringer ist, obliterieren die Gefässe.
3. Zur Sicherung des Lebens von
Knochenmark und Knochen entwickelt sich in der Umgebung der obliterierten
Gefässe ein neues feines Gefässnetz.
4. Ein Teil der Zotten des Lig. teres
ist pilzartig flach, die Gefässe in diesen gehen bis zur Membrana synovialis,
ein anderer Teil, an dessen nebelartigem Mittelteil Gefässe in grosser Zahl
anzutreffen sind, verlängert sich beduend.
5. Die Gefässe sind von Nerven
begleitet, deren Endzweige in den Gefässen verschwinden.
Zusammenfassung
1. Die Blutversorgung von Schenkelkopf
und -hals geschieht — wie embryologisch nachgewiesen werden konnte — aus zwei
verschiedenen Ursprungsgebieten.
2. Im Embryonalzustand ist eine
Verbindung zwischen diesen beiden Gebieten nicht vorhanden.
3. Bei der reifen Frucht dringen die
Gefässe der Fossa trochanterica bis zur Eintrittsstelle der A. capitis fem.
4. Der Verlauf der A. capitis fem. ist
beim Neugeborenen der Inanspruchnahme entsprechend gewunden.
5. Der A. capitis fem. kommt nicht nur
in der Versorgung des Kopfes, sondern auch in der Knochenmarkfunktion eine
bedeutende Rolle zu.
6. Anstelle der obliterierten Gefässe
des Lig. teres bildet sich im hohen Alter ein Gefässplexus, der den geringeren
Ansprüchen gerade genügt. Falls jedoch eine Verletzung der Gefässe eintritt,
reicht zur Befriedigung des Reparationsprozesses die Blutversorgung nur knapp
aus.
7. Die Zerreissung des Lig. teres ist
von schweren Knochenknorpelveränderungen und Funktionsstörungen begleitet.
Diese stammen nicht nur von der Verletzung der nutritiven Gefässe, sondern auch
von der Schädigung der diese begleitenden Nerven.
8. Die Spontanfraktur des proximalen
Endes der Schenkelbeine im hohen Alter ist mit der skizzierten Blutversorgung
zu erklären.
9. Auf Grund der Untersuchung des Lig.
teres älterer Personen erscheint die früher geäusserte Ansicht von Láng (1951),
dass im Interesse der Heilung im Hinblick auf die ungünstige Blutversorgung die
unverrückbare operative Zusammenfügung und Fixation der Bruchenden vollkommen
begründet sei, vollauf bestätigt. Damit geben wir die Möglichkeit zur
Gefässneubildung, d. h. zur Nutrition.
LITERATUR
1.
Carlquist
(1947): Comparison of the results etc. Acta Chirurgica Scand. Vol. XCV. Suppl.
127. Pag. 14.
2.
Chandler—A.
Kretischer (1932): A Study of the Blood Supply of the lig. teres etc. J.
Bone & Joint Surg. 14, 834.
3.
Christopher
(1940): Treatment of impacted fracture of the neck of the femur. J. Bone
& Joint Surg. 22, 161.
4. Granel (1949): Glomerules
vasculaires de la tête du femur. Comptes rendus de l’Association des
Anatomistes, Pag. 369—372.
5. Hoffa (1905): Lehrbuch der Orthopäd.
Chir. Pag. 553.
6.
Jacob-Testut
(1922): Traité d’Anatomie Topographique II. Band.
7.
Kolodny
(1925): The architect, & the Blood Supply etc. J. Bone & Joint
Surg. 23, 575.
8.
Láng
(1915): Beiträge zu Schenkelhalsfrakturen auf Grund anatomischer und klinischer
Studien. Orvosi Hetilap LIX. Jahrg.
9. Láng (1915): Dasselbe deutsch,
Deutsche Zeitschrift für Chir.
10. Láng (1929): Opera collecta
congressus V. internationalis etc. pag. 287.
11. Läng (1951): Beiträge zur Anatomie
des proximalen Femurendes usw. Magy. Tud. Akadémia Orvostud. Oszt.
közleményei II. Band Nr. 2—4, pag. 179—208.
12. Láng—Nagy (1952): Ein Beitrag zur
Chirurg. Anat. des proximalen Femurendes. Acta Morph. Scient. Hung. Tom.
I. fase. 3, pag. 199—206.
13. Láng—Gara—Kiss (1952): Diskussion
»Femurkopfnekrose nach Femurhalsnagelung«. Orvosi Hetilap, pag. 60—61.
14. Mihálkovics (1888): Lehrbuch der
beschreibenden und topographischen Anatomie des Menschen. Pag. 312.
15. Nikolajew, F. D. (1953): Zur Frage
des arteriellen Blutkreislaufs der Articulatio coxae. Archiv. Anatomii,
Gisztologii i embriologii 1. Tom. XXX. Pag. 55—63.
16. Ratkóczy (1949): Late complications
of traumatic dislocation of the hipjoint. J. of the Int. College of Surgeons,
Vol. XII., No. 5., Pag. 728—734.
17. Salem (1949): Nagelung und Spätresultate kindlicher Schenkelhalsbrüche usw. Wien, Klin. Wschr.
 |
| Abb. 1. Die Blutgefässe im Lig. teres eines 5 1/2 Monate alten menschlichen Embryos. Um die Fovea zerteilen sie sich zu einem schlingenbildenden Netz, a) Netz, b) Lig. teres fem. |
 |
| Abb. 2. Blutversorgung im Femurhals und Kopf eines sechsmonatigen Embryos. Von der Fossa trochanterica reichen die Gefässe bis in das Lig. teres. |
 |
| Abb. 3. Blutversorgung im Femurhals und Kopf einer neunmonatigen Frucht. Zahlreiche Blutgefässe in der Fossa trochanterica; Anastomosen zwischen den Gefässen von Hals und Kopf sind nicht vorhanden. |
 |
| Abb. 4. Arteriennetz des Lig. teres femoris einer ausgetragenen Frucht. Die A. capitis femoris (a) ist doppelt und gewunden. |
Abb. 5. Arteriovenöse Anastomose im Lig. teres femoris einer 21-jährigen Leiche: 1: Arterie, 2: Vene. Abb. 6. Gefässpolster im Lig. teres: a) Gefässpolster einer 21-jährigen Leiche. Abb. 7. Blutgefässobliteration im Lig. teres in hohem Alter (71 Jahre). Um die Obliteration herum hat sich ein Kapillargeflecht gebildet (a). |
 |
| Abb. 8. Kapillarversorgung des Lig. teres in hohem Alter (71 Jahre; nach Spalteholz durchsichtig gemacht). Die Gefässe sind mit Blut und nicht mit Injektionsstoff gefüllt. |
 |
| Abb. 9. Das die Kapillare des Lig. teres begleitende Nervennetz: a) Nerv, b) Kapillare. |
Láng A, Bálint J. Beiträge zur Anatomie des Ligamentum teres femoris. Acta
Morphologica – A Magyar Tudományos Akadémia Orvostudományi Közleményei. 1953;3(3)275-85.
real.mtak.hu
Adolf Láng. Institute of Anatomy, Budapest Medical University.
József Bálint. Institute of Anatomy, Budapest
Medical University.
ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, ligament of head of femur, anatomy, aseptic necrosis, embryology, pathology, role, blood vessels, blood supply
NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7
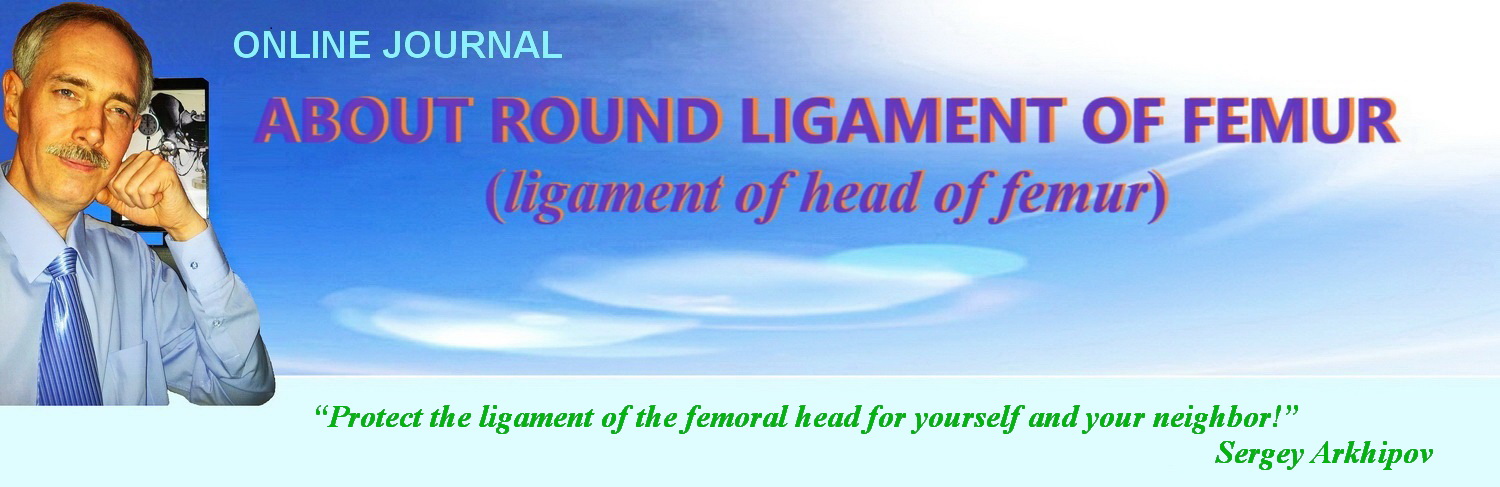

Comments
Post a Comment