Fragments
from the book: Braus H. Angeborene Gelenkveränderungen, bedingt durch
künstliche Beeinflussung des Anlagemateriales (1921). The author describes the
anatomy, attachment, shape, properties and changes in pathology of the
ligamentum capitis femoris (LCF). The text in German. The text in Russian is
available at the following link: 1921BrausH.
Quote pp. 523-524.
Eine Besonderheit der Hüftpfanne ist ein Fenster in ihrer Wandung. Der knöcherne Rand, an welchem die Pfannenlippe angeheftet ist, ist nach unten zw breit eingeschnitten, Incisura acetabuli (Abb. 90). Die Pfannenlippo ist trotzdem ein geschlossener Ring, weil die genannte Lücke durch ein Band, Ligamentum transversum acetabuli. überbrückt wird und weil die Pfannenlippe auf dieses Band fortgesetzt ist (Abb. 258). So ist der ventil artige Abschluß des Pfannenrandes gegen den Schenkelkopf gewahrt und trotz dem der Eintritt eines Bandes in den Innenraum des Gelenkes durch das Fenster unterhalb des Bandes möglich. Das Pfannenfenster wird umrahmt von der Incisura acetabuli und dem Ligamentum transversum. Das Bind im Innorn des Hüftgelenkes heißt Ligamentum teres femoris. Es ist nicht rund, wie sein Name vermuten läßt, sondern platt, dreikantig. Die Fossa acetabuli am Boden der Hüftpfanne, welche nicht vom Knorpel überzogen ist, ist mit Fett ausgepolstert; in dieses Polster ist das Ligamentum teres eingebettet. So wird die Rundung des Schenkelkopfes durch das zwischen Kopf und Pfanne eingelagerte Band nicht beeinträchtigt. Als Führungsflächc für den Schenkelkopf bleibt eine sichelförmige Fläche reserviert, welche allein überknorpelt ist, Facies lunata. Sie genügt, um ein exaktes Gleiten zu sichern, ähnlich wie beim Atlas nur Teile der elliptischen Gelenkfläche für den Schädel übrig sind, weil dort Platz für das Rückenmark tmd den Zahn des Epistropheus aus gespart wird (Abb. 72).
Nur die
Insertionsstelle des Bandes am Femur ist vertieft, Fovea capitis (Abb. 260),
aber die Grube ist beim nichtmazerierten Knochen durch das Band selbst
ausgefüllt. Das Lig. teres entspringt zweizipfelig vom Ligamentum transversum
und vom Rand der Incisura acetabuli. Wie der Darm mit der Leibeshöhlen wand
durch das Mesenterium verbunden ist (Abb. 9), so zieht es von der Gelenkwand
zum Schenkelkopf. Die Intima, welche die Innenwand der Gelenkkapsel austapeziert,
umkleidet auch das ganze Ligamentum teres und das Fettpolster in der Fossa
acetabuli , ähnlich wie das Peritonaeum in der Bauchhöhle die Wandung und die
Mesenterien überzieht. Man kann bei einem Reptil, bei welchem der Überschenkel
wagerecht vom Körper absteht (Abb. 152 a) und noch kein Ligamentum teres
vorhanden ist, künstlich eine Falte der Gelenkkapsel in die Gelenkspalte
hineintreiben, indem man den Überschenkel adduziert und nach unten unter den
Körper bringt, wie. es bei den Vögeln und den Säugetieren geschehen ist (Abb.
152b). Ähnlieh hat in der historischen Entwicklung die Umbildung der Extremität
zu einem Kniehebel dazu geführt, daß ein Teil der Kapsel zu einem intrakapsulären
Ligament wurde. Das Band liegt allerdings bei menschlichen Embryonen, sowie es
sichtbar wird, bereits innerhalb des Gelenkes. Aber bei manchen Säugerembryonen
(z. B. Tapir) ist es als mesenterienartige Platte mit der Kapsel breit in
Verbindung und wird erst nachträglich zu einem freien Band wie beim Menschen.
Als Best davon hat es beim Menschen außer den beiden oben genannten Ursprüngen
sehr häufig nocli einen dritten Ursprung von der Kapsel selbst.
Die
Korrelation zwischen der allgemeinen Form des Hüftgelenkes und dem Bestehen
eines Ligamentum teres beruht höchstwahrscheinlich auf folgendem, Die
Kapselinsertion muß bei einem Nußgelenk weiter distal rücken als bei einem Kugelgelenk,
weil die Pfanne bei ersterem mehr von der Oberfläche des Kopfes umfaßt und weil
trotzdem von der Kapsel nichts verloren gehen darf, um Spielraum genug für die
Beweglichkeit des Gelenkes zu lassen. Die Kapsel nickt also in toto distalwärts
(Abb. 261 b). Dadurch kommt von selbst die knorplige Epiphysenplatto mehr in
das Innere des Gelenkraumes zu liegen. Allerdings ist während der Hauptverknöcherungsperiode
der Epiphysenknorpel auch von der Diaphyse aus mit Gefäßen durchzogen (Abb.
259). Aber später ist die Epiphysenscheibe gefäßarm. Da Ästchen der Arteria acetabuli
innerhalb des Pfannenbandes verlaufen und mit ihm den Kopf erreichen (Abb.
258), so existiert hier ein Kollateralkreislauf, der für den Kopf den Wert
einer doppelten Sicherung hat. Es ist anzunehmen, daß Konflikte mit der
Ernährung des Gelenkkopfes durch die distale Verschiebung der Kapsel entstanden
wären, falls nicht die zufällige Möglichkeit bestanden hätte, den Kopf
unabhängig von der Diaphyse und dem Periost ausgiebig zu ernähren. Die
invaginierte Kapselfalte, die in den Gelenkraum hineingerät und zum Pfannen band
wird, ist dazu geeignet. Sie ist eine, der biologischen Voraussetzungen dafür, daß
ein so festes und doch bewegliches Nußgelenk wie das Hüftgelenk entstehen konnte
und bereits für den aufrechten Gang zur Verfügung war, als er von den Vorfahren
der Menschen erworben wurde.
Bei manchen
Säugern ist das Lig. teres zurückgebildet, aber in der embryonalen Entwicklung
noch nachweisbar (z. B. beim Igel). Auch beim Menschen kann es durch eine leere
Intimafalte. ersetzt sein oder ganz fehlen, besonders häufig bei Mißbildungen
(kongenitale Luxation). Die Gefäße im Innern können, ehe sie den Gelenkkopf
erreichen, umbiegen und rückläufig werden. Es geht daraus her vor, daß der Kopf
auch bei jugendlichen Individuen nicht ausschließlich durch das Ligamentum
teres ernährt wird. Bei intrakapsulärem Bruch des Schenkel halses (sog.
„Decapitatio") ist der Kopf lediglieh auf die Blutzufuhr durch das
Ligamentum teres angewioson. Bei jugendlichen Individuen heilen solche Brüche
(Epiphysenlösungen) häufig glatt, bei alten Leuten allerdings fast nie, da sich
die Gefäße, falls sie obliteriert sind, nicht neu zu bilden scheinen. Für
Greise werden sie häufig die indirekte Ursache des Todes, weil durch die
erzwungene Körperruhe Lungen erkrankungen hinzukommen. Aber auch dann ist der
Kopf bei der Sektion selten in Zerfall. Sein Blutbedarf ist sehr gering. Das
gleiche wissen wir von überlebendem Knochenmaterial, das zu Transplantationen
benutzt wird und außerhalb des Körpers oder an der Implantationsstelle lange am
Leben bleiben kann.
Über die
mechanische Bedeutung des Ligamentum teres siehe S. 528.
Der
Luftdruck setzt sich durch das Pfannenster auf das Fettpolster am Boden der
Pfanne fort und drängt dieses gegen den Kopf. Ein Zwischenraum zwischen Kopf
und Pfanne kann nicht entstehen, weil sofort der Fettpfropf angesaugt und von
außer halb des Gelenkes durch die Incisura acetabuli nachgeschoben wird. Für
die Wir kung des Luftdruckes auf den Zusammenhalt der Gelenkflächen kommen nur
die Facies lunata und das Labrum glenoidale in Rechnung. Die Blutzirkulation im
Ligamentum teres wird infolgedessen nicht durch den Luftdruck behindert. Bei pathologischen
Ergüssen in das Gelenk kann der Exsudationsdruck den Luftdruck überwinden und
die Kontaktflächen auseinanderdrängen. Das betreffende Bein ist dann scheinbar
länger.
Die
knöcherne Pfanne hat außer der Incisura acetabuli noch kleine Uneben heiten
ihres Bandes. Es sind leichte Buchten an den Stellen, wo die Kompo nenten des
Hüftknochens zusammenstoßen. Sie werden durch den faserknorpeligen Randstreifen
ausgeglichen, ebenso Unregelmäßigkeiten der Facies lunata durch den Belag aus
Hyalinknorpel. Da der Pfannengrund aus den drei Hauptknochen und dem Os
acetabuli aufgebaut wird (Abb. 225 c), so können in seltenen Fällen zeitlebens an
den ehemaligen Knorpelfugcn Stellen geringeren Widerstandes bestehen, wie der
Durchbruch eitriger Prozesse des Hüftgelenkes in das Becken und umgekehrt lehrt.
Vor dem 18. Lebensjahr sind die Knochen durch pathologische Prozesse leichter
voneinander lösbar als später, weil bis dahin die Knorpelfugen nicht ver knöchert
sind.
Quote p.
527.
Bei
der distalen Verschiebung der Gesamtkapsel (Abb. 261) sind gefäßhaltige Teile
der Kapsel, Ligamenta cervicis (s. Retinaknla), erhalten geblieben. Einzelne
Gefäße dringen unter dem Kapselansatz hindurch sogar bis zur Epiphysenfuge vor.
Die meisten Gefäßlöcher liegen aber extrakapsulär auf der Hinterseite des
Schenkelhalses.
Der
Kapselansatz hat sich sekundär vom Knochen auf das Ligamentum transversum
zurückgezogen und läßt mit seinem Ursprung die Incisura acetabuli frei. Am
Ligamentum transversum ist er manchmal wie am Schultergelenk breit mit der
Pfannenlippe verlötet (Abb. 260). In allen Fällen bleiben die Gefäße des Ligamentum
teres rein extrakapsulär und gleichen auch darin den extra- oder retroperitonaealen
Mesenterialfalten in der Bauchhöhle.
Quote pp.
528-529.
c)
Verstärkungsbänder des Hüftgelenkes.
Die
Kapsel setzt sich zusammen aus der Intima, welche zu innerst den ganzen
Kapselraum auskleidet, und aus einer Fibrosa, welche nach außen zu die Intima
überdeckt und verstärkt. Außerdem sind besonders starke Ver stärkungsbänder in
die Fibrosa eingewebt. Die zwischen ihnen freibleibenden Teile der Kapsel sind
dünn und manchmal buchtig, Recessus. Bei pathologischen Ergüssen oder
künstlichen Injektionen quellen die Recessus vor, sind aber in der Norm schlaff
und leer. Die normale Gelenkschmiere, Synovia, besteht nur aus soviel
schleimiger Flüssigkeit, wie nötig ist, um die Knorpelflächen schlüpfrig zu
erhalten. Der Gelenk,,räum" ist auch hier nur potential vorhanden. Normal
ist er eine kapillare Spalte. Aber unter dem Druck von pathologischen Exsudaten
oder künstlichen Injektionsmassen kann jederzeit die dem Skelett angeschmiegte
Kapselwand abgehoben und, wenn der Druck genügend steigt, die Spalte zwischen
den überknorpelten Gelenkflächen so weit ausgeweitet werden, daß wirklich ein
„Raum" entsteht.
Das
Mittelalter hat die praktische Probe darauf gemacht, wie stark die Verstärkungsbänder
am Lebenden sind. Bei der Vierteilung von Verbrechern soll die Kraft von vier
starken Pferden nicht genügt haben, das Hauptverstärkungsband, Lig.
üiofemorale, zu zerreißen. Bei der Leiche wurde in einem Fall seine maximale Tragkraft
(Zugfestigkeit) auf 350 Kilo bestimmt. Die Achillessehne trägt gegen 400 kg.
Ligamentum
teres
Die
Verstärkungsbänder der Hüftgelenkskapsel werden eingeteilt in Außen- und
Innenbänder, extra- und intrakapsuläre Ligamente. Zu den letzteren gehört nur
das Ligamentum teres femoris (Abb. 260), welches wegen seiner Beziehungen zur
Gesamtform des Gelenkes oben bereits beschrieben wurde (S. 523). Für den
Zusammenhalt der Gelenkflächen kommt es nicht in Betracht, da es erst gespannt
wird, wenn der Kopf die Pfanne bereits verlassen hat (Luxation). Es ist fraglich,
ob es als Hemmungsband für extreme Bewegungen im Hüftgelenk des Menschen von
Bedeutung ist. Seine Tragkraft schwankt zwischen 15 und 75 kg.
Das Band liegt so, daß es bei starker Vorhebung des Oberschenkels dessen äußerste Adduktion und Außenrotation hemmen könnte. In dieser Stellung ist das Ligamentum iliofemorale (siehe unten) erschlafft und unwirksam. Es ist an der Leiche gelungen, das Lig. teres durch forcierte Bewegungen in der genannten Richtung zu zersprengen, ohne daß Außenbänder zerrissen. Auch bei rein knorpligen gefäßloson Gelenkköpfen (Schultergelenk der Unke) kommt ein intrakapsuläres iig. teres vor; die nutritorische Bedeutung (S. 524) ist also nicht die einzige. Nicht ohne Wichtigkeit für das geräumige Hüftgelenk mag sein, daß die Ausscheidung der Synovia durch die vergrößerte Intima, welche das Band überzieht, begünstigt wird, und daß es die Synovia im Gelenkraum gleichmäßig vertreibt und verteilt.
Zona
orbicularis
Von
den vier Außenbändern nenne ich zuerst das Ringband, Zona orbicularis. Es legt
sich wie ein enger Kragen um die dünnste Stelle des Schenkelhalses. Die Fasern
springen am stärksten nach innen zu gegen die Intima vor (Abb. 260) und sind
von da aus am leichtesten zu finden. Läßt man die losgelöste Kapsel zwischen
den Fingerkuppen durchgleiten, so fühlt man das verdickte Ringband deutlich.
Von außen ist das Band durch die übrigen drei Verstärkungsbänder fast ganz
verdeckt. Es ist an der Leiche nicht immer leicht zu präparieren, weil es am
wenigsten scharf begrenzt ist, besonders an der Vorderfläche der Kapsel
(deshalb der Name „Zona" statt „Ligamentum"), und weil es mit den
übrigen Außenbändern durch gemeinsame Bündel verbunden ist. Die letzteren sind
ein wichtiger Tragapparat für das Ringband, welcher dessen Abstand vom
Pfannenrand feststellt. Der Schenkelkopf ist durch die Zona orbicularis wie
durch ein Knopfloch hindurchgesteckt. Er ist frei in ihr drehbar, kann aber die
Pfanne nicht verlassen, solange das Knopfloch nicht einreißt oder im ganzen von
der Pfanne losgerissen wird (Tragapparat). Neben der Pfannenlippe (1.) und der
Luftdruckwirkung (2.) stellen wir hier eine neue Einrichtung (3.) fest, welche
den Kontakt von Pfanne und Kopf sichert und die Muskulatur entsprechend
entlastet.
Die drei übrigen Außenbänder sind die eigentlichen Hemnnuigsbänder, welche den Bewegungen des Gelenkkopfes in der Pfanne eine bestimmte Grenze setzen. Jedes entspringt an einem anderen der drei Teile des Hüftknochens.
Quote p.
538.
b)
Der Verkehrsraum des Hüftgelenkes.
Das
distale Ende des Femur beschreibt eine Kugel schale, in deren Zentrum der Drehpunkt
des Schenkelkopfes liegt, Bahnkugel (Abb. 270). Zeichnet man mit dem distalen Ende
des Femur alle Extrem lagen wie mit einem Schreib hebel auf die Innenfläche des
Globus auf, so bekommt man die Grenzlinie für den Ver kehrsraum des Gelenkes.
Inner halb der Grenzlinie ist jeder be liebige Punkt für das distale Femurende
erreichbar. Die gezeichnete Grenzlinie kann nur erreicht werden, wenn die spiralige
Drehung der Bänder des Hüftgelenkes abgewickelt und die Bänder entspannt sind,
wozu für jede Stellung eine bestimmte Rotationsstellung des Oberschenkels
gehört. Sie ist in die
Grenzlinie eingetragen durch Pfeile, welche in der Richtung der beiden distalen Kondylen des Femur stehen. Die Spitzen der Pfeile zeigen in der Gleichen Richtung wie der Condylus medialis, geben also auch die Richtung des Schenkel kopfes für jede Extremstellung an. Die Bänder, welche das Femur verhindern, den Verkehrsraum des Gelenkes zu überschreiten, können wie Anschläge auf gefaßt werden. Die Marke für das Lig. iliofemorale beispielsweise bezeichnet die Seite und die Strecke der Grenzlinie, an welcher das Band als Anschlag wirkt (es ist nicht die Lage des Bandes gemeint; diese ist gerade entgegen gesetzt). Die Blockierungslinien für die anderen Hemmungsbänder sind ebenso eingezeichnet. Außerdem ist die Muskulatur eine wichtige Bremse, welche beim Lebenden gewöhnlich keine maximalen Ausschläge zuläßt, sondern all seitig hemmt, bevor die Grenze der im Gelenk möglichen Bewegungen er reicht ist.
Quote p.
539.
Auch beim Muskelpräparat ist der Verkehrsraum des Hüftgelenkes einge schränkter als beim Bändorpräparat, weil der passive Widerstand vieler Muskeln früher hemmt als die Bänder. Die Blockierung nach oben zu ist durch Muskeln auf der Hinterseite des Hüftgelenkes bewirkt (Glutaeus maximus u. a.), nach innen zu durch Muskeln auf der Außenseite des G-elenkes (Glutaeus medius, minimus u. a. ; vgl. die Richtungslinien der Abb. 246). Die Verteilung an der Leiche ist so, daß nach oben und innen zuerst die Muskelhemmung und dann die Bandhemmung überwunden werden muß, ehe der Verkehrsraum überschritten werden könnte, daß nach unten und außen beide Blockierungen gleichzeitig gesprengt werden müßten. Die Erfahrung lehrt, daß der schwache Punkt dieser Konstruktion oben und außen liegt, offenbar, weil hier zwischen den schwächsten Bändern, dem Ligamentum teres und L. pubocapsulare, die Blockade nicht immer genügt. Die Hemmungs muskeln für die Außenseite, die Adduktoren, die lang und dehnbar sind, versagen zuerst. Nach dieser Seite zu, d. h. in Abduktionsstellung, ereignen sich fast alle Hüftgelenksverrenkungen. Die Kapsel reißt nach unten zu ein.
External links
Braus H. Anatomie
des menschen; ein lehrbuch für studierende und ärzte. 1. bd.
Bewegungsapparat. Berlin: J. Springer, 1921. archive.org
Authors
& Affiliations
Hermann Braus (1868–1924) was a German anatomist, a
professor of comparative zoology at the University of Heidelberg and of anatomy
at the University of Würzburg. wikipedia.org
Keywords
ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, ligament of head of femur, anatomy, pathology, role, attachment, shape, properties, absence, blood supply
NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7
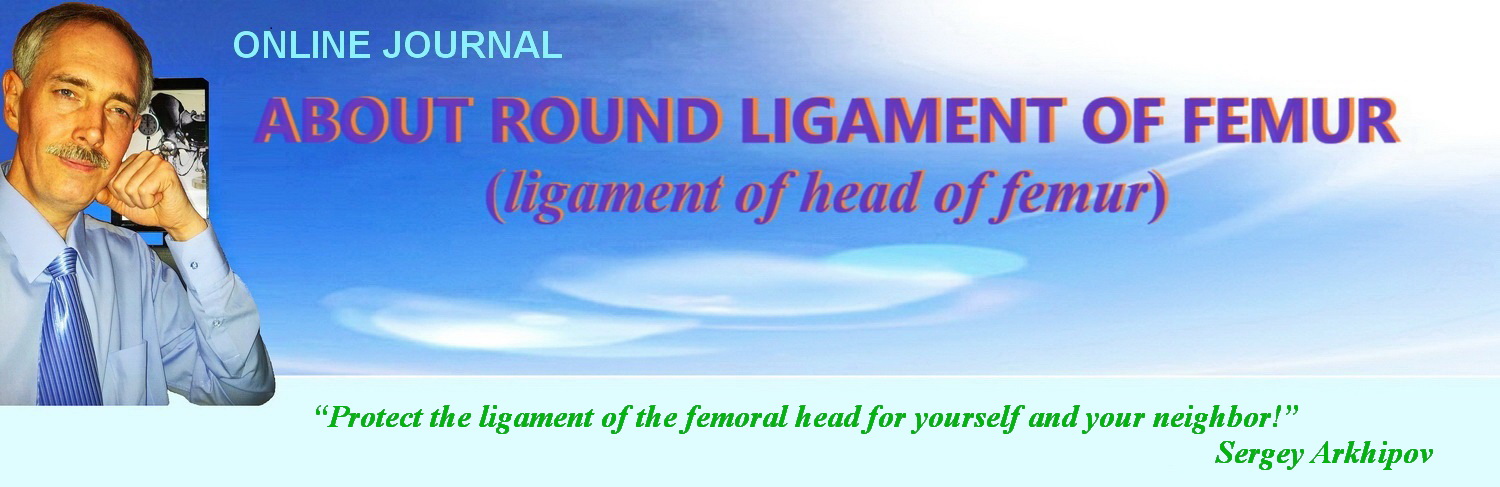




Comments
Post a Comment